|
Umfassende Bereiche:
1. Zur Methode
Als Orientierungshilfe für die eigene persönliche oder
gesellschaftliche Tätigkeit dient alles angeeignete Wissen.
Aber bereits das Aneignen des Wissens erfolgt persönlich
und auch kollektiv nicht vollständig, sondern eher selektiv.
Oft erfolgt die Aufnahme neuen Wissens aus Gründen der Bequemlichkeit
oder auch der "Denkökonomie" nur soweit, wie alte
Vor-Urteile bestätigt werden.
Uns interessieren Erfahrungen aus allen Gebieten des Seins und
Denkens, um unsere Orientierung auf dem Gebiet der Gesellschaft
zu verbessern. Wir müssen dabei aufpassen, nicht kurzschlüssigen
Analogien zu verfallen, die nur einseitige Positionen stützen.
Bei der Übernahme biologischen Wissens ist das besonders
gefährlich. Einerseits kann die Rolle der biotischen Konkurrenz
betont werden, dann entsteht der berüchtigte Sozial-Darwinismus als
Begründung des gesellschaftlichen Zustands des Kampfs aller
gegen aller und jedes gegen jeden. Die gegenteilige Überbetonung
der Harmonie alles Lebendigen (bspw. in manchen Interpretationen
des Gaia-Konzepts) dagegen verabsolutiert eine Widerspruchslosigkeit,
wie sie auch in der Biologie nicht real gegeben ist. Konkurrenz
und Kooperation gibt es in der Biologie. Ein anderes Beispiel
ist das Verhältnis von Differenzierung und Synthese. Beide
Effekte treten gleichzeitig auf (aus der Philosophie kennen wir
das Grundproblem der Einheit des Mannigfaltigen...). Üblich
ist aber die Verabsolutierung jeweils eines Effektes, wobei in
der Gesellschaft dann einseitig auf Differenzierung (Luhmann)
gesetzt wird, oder auf die Synthese (New Age-Theoretiker/innen).
Letztlich zeigt eine genaue Rückfrage in der betreffenden
Ausgangswissenschaft, hier in der Biologie, die Einseitigkeit
auf.
Ich selbst habe beim Schreiben meines Buches diese Erfahrung mehrmals
gemacht. Vor dem Schreiben hatte ich z.B. neue biologische Erkenntnisse
zur Symbiose (L.Margulis) gelesen und mich hatte das als Erkenntnis
für die gesellschaftstheoretische Orientierung sehr gefreut.
Auf Grundlage des damaligen Wissensstandes hätte ich als
"Schlüsselerfindung" sicher die Symbiose allein
hingestellt. Bei der ernsthaften Arbeit am Thema konnte ich an
den gegenteiligen biologischen Theorien nicht mehr vorbei (mein
Buch würde sich sicher besser verkaufen lassen, wenn ich
die New-Age-Richtung einfach weiterverfolgt hätte). Aber
in der Biologie war es doch nicht so einseitig, sondern die Differenzierung,
auch die Konkurrenz spielte nichtdestotrotz auch in den von L.Margulis
beschriebenen Prozessen ihre berechtigte Rolle. Das Verhältnis
von Synthese und Differenzierung tauchte in der Biologie in meinen
Studien zweimal auf. Einmal war eine Entweder-Oder-Entscheidung
notwendig (die ich nicht treffen kann, sondern den Fachwissenschaftlern
überlassen muß). Im günstigeren Fall jedoch war
dies nicht unbedingt eine Entscheidung "Entweder-Oder",
sondern die Grundgedanken beider Grundeffekte (Synthese
und Differenzierung) gemeinsam ergaben erst ein tieferes Verständnis
der Realität und damit auch eine genauere Orientierung für
das Gesamtdenken.
Auf diese Weise wurde für mich die alte philosophische Methodik:
"These Antithese Synthese" praktisch wirksam. Beide
Thesen müssen in ihrer Differenziertheit in der Theorie untersucht
werden, bis sie zu einer Erkenntnissynthese führen.
Die "Zusammenschau" vieler Erkenntnisse steht also einerseits
vor dem Problem, daß Einseitigkeiten sich selbst verstärken.
Deshalb ist erstens eine wirklich gründliche Recherche im
Ausgangs-Wissensgebiet notwendig, wobei die Übernahme des
für das eigene Vor-Urteil Günstige nicht ausreicht.
Zweitens erfordert die Übernahme von Erkenntnissen in ein
anderes Gebiet die "Übersetzung" in allgemeinere
Denksysteme und anders verankerte Fragestellungen.
Es steht ja überhaupt zur Debatte, wie die Gesetzmäßigkeiten
des Seins in ihren bereichsübergreifenden Zusammenhängen
erfaßbar sind. Einzelwissenschaften wie Kosmologie, Biologie und Gesellschaftstheorie erfassen das Wesen der Dinge und Prozesse auf den jeweiligen Ebenen der Strukturniveaus.
Direkte Übertragungen zwischen den Einzelwissenschaften können
zu falschen Schlußfolgerungen führen, besonders wenn
in der Ausgangswissenschaft bereits ein Aspekt einseitig verabsolutiert
wurde. Diese "Kurzschlüsse" sind nur durch allgemeinere
und gleichzeitig tieferlotende Untersuchungen über die Ursachen
und Prinzipien der Gemeinsamkeiten zu verhindern.
Gemeinsame "Muster" in der Struktur des Seins, des
Verhaltens und auch der Evolution werden durch allgemeine
Wissenschaften wie Kybernetik, Synergetik oder Chaostheorie
u.a. abgebildet (Das Verhältnis der einzelnen Allgemeintheorien
ist auch zu untersuchen. Oft wird im Populären eine einzige
hervorgehoben und alles andere ihr untergeordnet. Speziell Autopoiese
und Selbstorganisation sowie Synergetik stehen im "Wettstreit"
ihrer jeweiligen Autoren und Vertreter.)
Die Philosophie selbst wird erst
berührt, wenn das menschliche Sein als Teil der wissenschaftlichen
Fragestellung mit widergespiegelt und hinterfragt wird (Sie
erhellt deshalb die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen der
verschiedenen Autoren der Allgemeintheorien und kann Verabsolutierungen
aufdecken).
Der Begriff der Praxis ist dafür
bestens geeignet, weil er mehr erfaßt als die reine "Widerspiegelung",
das nur-geistige Erkennen. Gleichzeitig verweist er auf die jeweils
historische Gebundenheit allen Erkennens und die Grundlegung des
menschlichen Seins in seiner jeweils historisch bestimmten Lebenspraxis.
2. Evolutionsprinzipien
Wenn ich jetzt die Zusammenfassung meiner Erfahrungen zu Evolutionsprinzipien
versuche, so wird dies hier vorwiegend auf der allgemeinen, nicht
der philosophischen Ebene erfolgen. Eigentlich wird eine tiefere
Einheitlichkeit und Einheit erst beim Bezug auf originär
philosophische Begriffsbildungen sichtbar. Beim Schreiben meines
Buches habe ich festgestellt, daß ich immer öfter nicht
stehengeblieben bin bei der allgemeintheoretischen Benennung,
manchmal sogar nur "Etikettierung" von Prozessen - sondern
in der Philosophie (besonders Hegels) tiefere Fundierungen gefunden
habe.
Die Reihenfolge der Benennung der Prinzipien folgt sachlichen
(und damit logischen) Begründungen vom Sein zur Veränderung
bis hin zum maßüberschreitenden Sprung in neue Qualitäten.
1. Die
Welt ist strukturiert. Es hängt zwar tatsächlich irgendwie
"alles mit allem" zusammen, aber zwischen den Dingen
und Prozessen existieren wesentliche Zusammenhänge (Gesetze),
die spezifische Einheiten (räumliche, aber auch prozeßhafte
Systeme) in
Unterscheidung von ihrer Umgebung strukturieren. Diese Einheiten
unterscheiden sich durch die sie konstituierenden Gesetzmäßigkeiten
- durch ihr ihnen eigenes Wesen - von allen anderen. In ihnen
existieren i.a. weitere Einheiten und die Ausgangs-Einheiten selbst
sind Bestandteile anderer, umfassenderer Einheiten. Diese Relativität
läßt sich am besten erfassen durch das System-Element-Verhältnis.
Der Systembegriff ist auf diese Weise inhaltlich-qualitativ (nicht
wie in der herkömmlichen Kybernetik nur quantitativ) bestimmt.
2. Diese
relativ stabilen Strukturen konstituieren sich durch innere
Prozesse, wobei die systemhaften Strukturen
ihre eigenen Bestandteile selbst erzeugen. Diese allgemeine
Tatsache wurde für die Biologie erstmals im Autopoiese-Konzept
verallgemeinert (wobei die Autopoiese nur die Existenz
der individuellen Einheit untersucht, nicht die Aufeinanderfolge
von Generationen. Sie kann deshalb die biotische Evolution nicht
erfassen.)
Etwas allgemeiner ist hier das Selbstorganisationskonzept,
da hierbei das "kooperative Wirken von Teilsystemen
zu komplexen Strukturen des Gesamtsystems" (Ebeling, Feistel:
Physik der Selbstorganisation und Evolution, 1986, S.11) nicht
nur in der Aufrechterhaltung der Existenz, sondern der Entstehung
neuer Strukturen wirksam wird.
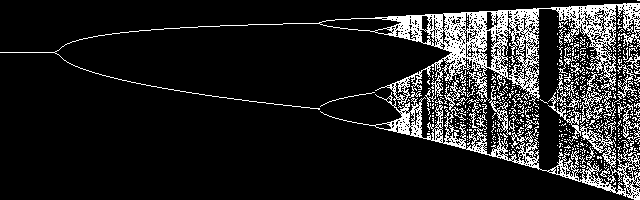
Für die Selbstorganisation sind folgende Voraussetzungen
notwendig (dies als Hintergrund für Bedingungen der sozialen
Selbstorganisation!):
3. Die Prozesse zur Aufrechterhaltung der Existenz verändern die Bedingungen der Existenz. Sie sind deshalb irreversibel.
Veränderte Bedingungen sind einerseits Grundlage für
das "Erschöpfen", das Altern von Zuständen.
Andererseits sind sie die Grundlage dafür, daß Neues
entstehen kann. 4. In jedem Zustand existieren Dinge und Prozesse, die Zusammenhänge realiseren. Andere Zusammenhänge sind einerseits bereits in diesem Zustand möglich, aber nicht wirklich realisert. Neue Zusammenhänge können auf Grundlage dieser anderen entstehen und sich realiseren, wenn neue Zustände entstehen.
Die Möglichkeit
innerhalb der Wirklichkeit ist die Grundlage für Flexibilität
und Entwicklung von Neuem. 5. Jede Qualität hat ihr begrenzendes "Maß". Die Grundqualität eines Bereiches ist deshalb nie "uferlos". Der alte Zustand gerät im Laufe der Bedingungsveränderung an Grenzen seiner qualitativen Entwicklung. Das "Maß" seiner Qualität wird erreicht. Daß dies geschieht, liegt an der "selbstorganisierten Kritizität". Im Rahmen der Realisierung seiner typischen, wesentlichen Zusammenhänge (der Aufrechterhaltung seiner Existenz) kann der Zustand nicht anders (Kontraproduktivität aller Versuche, innerhalb des Rahmens alter Gesetze etwas "zu retten"), als die Bedingungen seiner Existenz irreversibel zu verändern, bis die Bedingungen seine Existenz innerhalb dieser Gesetze nicht mehr ermöglichen. Dann ist das Ende seiner Existenz erreicht - oder es gelingt ihm, neue qualitative Zustände einzunehmen, neue wesentliche Zusammenhänge (Gesetze) auf Grundlage der neuen (von ihm selbst erzeugten) Bedingungen zu realiseren. 99% aller jemals existierenden Tierarten sind ausgestorben. Nur noch 1% existieren, wovon wiederum nur ein Bruchteil sich "höher"-entwickelte. Vernunftbegabte Zivilisationen könnten eine höhere "Erfolgsrate" haben, weil sie bewußte Entscheidungen treffen können sollten... 6. Weiter betrachten wir den möglichen (aber unwahrscheinlichen, siehe oben) selbst-organiserten "Sprung" in neue Qualitäten. Voraussetzungen dafür sind (siehe vorn):
Zusätzlich ist es typisch, daß die neuen wesentlichen Zusammenhänge (Gesetze)
7.
Es entsteht "im" Sprung eine Vielzahl neuer Varianten
von möglichen neuen Zuständen (biologische Radiation).
Dies beruht auf der Unerschöpftheit der neuen Bedingungen/Ressourcen
(ökologische Nischen). Erst im späteren Verlauf setzen
sich nur einige der neuen Varianten in der Konkurrenz um die knapper
werdenden Ressourcen durch.
Bei der Ausbildung neuartiger Komponenten ist das Prinzip des
Funktionswechsels wesentlich.
Einmal vorhandene Strukturen übernehmen neben der bisherigen
Funktion neue Funktionen oder bisher unwesentliche Nebenfunktionen
werden zu wesentlichen Hauptfunktionen (Gehörknöchelchen
entstanden aus Kiemenknochen).
8.
Zu beachten ist der unterschiedliche Zeithorizont von Veränderungen
auf den verschiedenen Ebenen der Seins-Struktur. Qualitative Umbrüche
auf einer Ebene sind nur Veränderungen aus der Sicht der
jeweils Umfassenderen. Insgesamt ergibt sich jedoch eine Ko-Evolution
von Einheiten auf der gleichen Ebene, aber auch eine Ko-Evolution
(durch gegenseitige Bedingungsänderungen) der Einheiten
verschiedener Ebenen.
Dabei gilt: einige Ebenen erreichen neue Qualitäten nur auf
der Grundlage, daß die anderen Ebenen sich kooperativ in
die neuen Zusammenhänge einbringen. Wir Menschen haben mehr
lebensnotwendige "primitive" Bakterien in unserem Körper,
als es Menschen auf der Erde gibt.
"Kooperation" kann in diesem Zusammenhang auch "Versklavung"
heißen (wie zuerst in der Synergetik bei H.Haken, was er
später in "Konsensualisierung" umbenannte). Was
es im Sinne der Anwendung für die Gesellschaft jeweils konkret
bedeutet und bedeuten soll ist eine Frage der menschlichen bewußten
Entscheidung und nicht scheinwissenschaftlich aus der Einzel-
oder Allgemeinwissenschaft "vorgegeben"!!!
9.
Entwicklung bedeutet : Neuentstehen von Möglichkeiten,
aber auch der Abbruch früherer Möglichkeitsfelder durch
die Bedingungsänderung. Früher noch Mögliches wird
unmöglich. Einige der Möglichkeiten "frieren
ein", verhindern die Existenz der jeweils entgegengesetzten
früheren Möglichkeit (genetischer Code, linke "Spiralität"
der Kohlenstoffmoleküle des irdischen Lebens, spätere
Stammbaumabzweigungen...)
Eine Rückkehr zum Alten ist nicht möglich, nur eine
"spiralförmige" Entwicklung. Schildkröten,
die mehrmals zwischen Wasser- und Landleben wechselten, entwickelten
mehrmals einen Panzer, der sich wieder rückentwickelte. Es
war nie derselbe Panzer, sondern die Relikte aller Panzer sind
übereinander gelagert noch zu erkennen. Günstiger ist
es, wenn diese scheinbare Rückkehr neue, qualitativ höhere
Zustände erreicht, wo eine echte Höherentwicklung vorliegt.
Dann hat sie die Eigenschaft, ihre "Negationen zu negieren".
Es gibt hierbei kein allumfassendes Maß des "Höher"
(auch die "Komplexitätssteigerung" reicht nicht
aus, weil sie die betrachteten Einheiten und ihre Wechselwirkungen
nicht genau genug faßt).
10.
Die Evolutionsprinzipien evolvieren selbst. Indem
mit der Entstehung neuer Qualitäten neue Gesetzmäßigkeiten
entstehen, entstehen auch neue Formen der Evolution. 11. Für die Evolution des Lebendigen scheint es einige Merkmale zu geben, wie:
12.
Die gesellschaftliche Evolution kann
nicht einfach aus den vorherigen Erkenntnissen abgeleitet werden.
Die spezifischen Gesetze und Triebkräfte können nur
aus der Erkenntnis der Gesellschaft selbst erkannt werden. Es
ist zu erwarten, daß neue Gesetzmäßigkeiten entstehen,
die die alten wesentlich überlagern und z.T. außer
Kraft setzen können (das betrifft nicht die Außerkraftsetzung
physikalischer oder biotischer Zusammenhänge als Grundlage
für das Gesellschaftliche ). Die Entwicklung der Menschheit
beruht auf materiellen Grundlagen - sie kann physikalische oder
biotische Zusammenhänge nicht aufheben, sondern nur erkennen
und nutzen. Das Nutzen kann einerseits im Sinne einer "Überlistung"
(E.Bloch) geschehen - dies aber ist nur eine der möglichen
Umgangsformen und führt dazu, daß die materiellen Zusammenhänge
"zurückschlagen", wenn die Überlistung zu
einer Veränderung der Lebensbedingungen über das mögliche
Maß hinaus geführt haben. Andererseits wäre eine
Nutzung im Sinne der Ko-Evolution möglich. Auch "die
Natur ist kein Vorbei" (Ernst Bloch,
siehe auch A. Schlemm in "Ökovision" Nr.2, S. 21)
und wartet darauf, sich durch und mit ihrem höchstentwickelten
Teil Menschheit weiterzuentwickeln.
All diese Prinzipien tauchen in meinem Buch
("Daß nichts bleibt, wie es ist..." LIT-Verlag,
1996) mehrere Male an den verschiedenen Stellen der Evolution
vom Urknall bis zum Menschen auf. Darin stehen dann auch die "Beispiele".
Ein typisches Beispiel will ich hier nur andeuten: Ein Beispiel für Qualitätssprünge ist das Entstehen der Eukaryoten.
Die ersten Einzeller (ohne Zellkern, Prokaryoten) erzeugten den
ersten Sauerstoff. Und als der Sauerstoff schließlich in
die Luft gelangte, drohte sich das einzellige Leben selbst damit
zu vergiften (Sauerstoff ist ein Zellgift). Die Lösung gelang
durch innere zellulare "Umbauten" (Schutz vor Zellgift)
und die Weiterexistenz war nur möglich, indem sich weitere
Einzeller entwickelten, die lernten, Sauerstoff abzubauen und
Kohlenstoff als Nahrungsgrundlage für die Anderen freizusetzen.
Notwendig für eine innovative Lösung war also die
Man kann einiges lernen für unsere Situation der Menschheitsprobleme!
siehe auch:
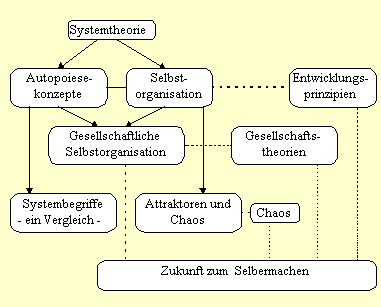
|