|
Die Anwendung von Systemtheorien auf gesellschaftliche Probleme ist schon lange modern. Die unterschiedlichen Systembegriffe aus unterschiedlichen Konzepten sind oft die Ursache für Verwirrung. Ich versuche eine Zusammenfassung verschiedener Konzepte, die auch die Konsequenzen für Gesellschaftstheorien andeutet. 2. Systemtheorien 3. Systemtheorie und Gesellschaft 4. Entwicklung Ein Systeme ist ein 1. Bereich der Wirklichkeit, der sich 2. von anderen (wesentlich) unterscheidet, und 3. selbst eine (durch wesentliche Zusammenhänge gekennzeichnete) Einheit darstellt.
1.: Die Wirklichkeit kann stofflich und/oder energetisch und/oder informationell und/oder geistig-seelisch konstitutiert sein.
2.: Das System unterscheidet sich von seiner (mit ihm interagierenden) Umwelt und den anderen Weltbereichen. Autopoietische Systeme (als Spezialfall) bilden ihre Unterscheidungsränder selbst aus.
3.: Einheit/Ganzheitlichkeit in verschiedenen "Tiefen":
Das Wesen wird nicht nur durch den Betrachter hinein"gesehen" und "gedeutet", sondern "auch die Gegenstände sind "so beschaffen..., daß sie eine Wesentlichkeit oder ein Fürsichsein an ihnen haben." (Hegel. Phänomelogie, S. 168)
d) Ein System bildet eine Totalität, wenn in dem Wesen ein vollständiger innerer Gegensatz enthalten ist. C.Warnke betont, daß diese wesentliche innere Widersprüchlichkeit nicht im Abstrakten enthalten ist, sondern nur im konkret-Abstrakten. Sie will deshalb den Dingbegriff statt des Systembegriffs (der bei ihr nur das Abstrakte enthält) wieder einführen.
siehe auch: Was sind Systeme? orientieren antireduktionistisch auf Ganzheitlichkeit, können aber oft nicht vermeiden, "nach oben" reduktionistisch zu werden (nur noch das Ganze zu verabsolutieren, ohne die Differenzierungen ausreichend zu betrachten). Die erste Etappe der Systemtheorien ist von der sog. Allgemeine Systemtheorie (Bertalanffy 1968) in Form von Kybernetik, Informationstheorie, Spieltheorie und Operations Research gekennzeichnet. Im Zentrum steht hier meist ein zustandsdeterminiertes System im fließenden Gleichgewicht (Homöstase), dessen Adaption an gegebene Umweltbedingungen betrachtet wird.
Seit Anfang der 70er Jahre entwickelt sich eine neue Systemtheorie , die Instabilitäten, katastrophische Strukturbrüche, der Steuerung entzogene Selbstorganisation in den Mittelpunkt der Betrachtungen rückt. Dieser Wandel korrespondiert mit dem Stimmungwandel der Sozialwissenschaft in späten 70er Jahren ( "Unregierbarkeit", Grenzen der keynesschen Steuerung (Müller)). 3. Systemtheorie und Gesellschaft Gesellschaftstheorien haben es auch mit
- Wirklichkeitsbereichen zu tun, Wird jedoch ein beschränkter Systembegriff dafür unterstellt, kommt es zu Verkürzungen:
Manche Systembegriffe sind nicht qualitativ, nicht wesenserfassund und nur als stabiles System ohne Entwicklung definiert. Die daraus abgeleiteten Systemtheorien der Gesellschaft werden berechtigt kritisiert durch Padrutt, Warnke, Bahro ("subjektlose Soziologie") u.a. Mit ihnen wird Herrschaft objektiviert und bei der Betonung des Unvorhersagbaren jeder bewußten Planung eine Absage erteilt. Neuere Untersuchungen erkennen die Nichtlinearitäten (Bühl, Beckenbach/Diefenbacher) und orientieren auf Multistabilität, d.h. auf ultrastabile Subsysteme mit loser Kopplung (Bühl). Diese versuchen immer noch, die vorhandenen gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten trotz ihrer Nichtlinearitäten in ihren wesentlichen Qualitäten aufrechtzuerhalten (konservativ).
Andere Modelle nutzen das Wissen um die Notwendigkeit und die Art und Weise von qualitativen Umbrüchen an Bifurkationspunkten zur Orientierung auf gesellschaftliche Umbrüche. |
| Gleichgewicht | Nichtgleichgewicht | |
| konservativ | Volkswirtschaftslehre Luhmann Autopoiesis |
Chaos und Katastrophen für "freie" Marktwirtschaft - gegen Steuerungsintervention |
| Kritik an Konservativen | Gesellschaft als System: Menschen/Interessen verschwinden (Systemtotalität beherrscht Subjektivität) |
|
| alternativ | Klassenkampfkonzepte mit statischen Klasseninteressen... | "Gesetz aufdecken"=Möglichkeiten zeigen, die zur Verwirklichung drängen
(Hörz); Wissenschaft begründet Handlungsalternativen (Quaas) unter Beachtung der Dialektik von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Phasen mit entsprechenden Möglichkeitsfeldern... |
|
4. Entwicklung
Es wird allgemein anerkannt, daß alle Systeme sich entwickeln. Wenigstens Teilaspekte der Entwicklung von System und Systemen werden immer wieder genannt:
Entwicklung wird z.B. betrachtet als "Spiel mit den Möglichkeiten des Aufbaus immer komplexerer Systeme, die sich zwar gegenüber ihrer äußeren Umwelt auch behaupten (Darwin)., die aber darüber hinaus zusätzlich ihre innere Kombinatorik von Teilen, Funktionen und Prozessen steigern und damit gegenüber ihrer Umwelt qualitativ neue Freiheitsgrade zu verwirklichen vermögen." (Willke, S. 89). Das Hörzsche Kriterium für humanen Fortschritt - der Freiheitsgewinn der Persönlichkeit - wird dabei erfüllt. Auch Luhmann betont gegen den Adaptionismus die Eigenaktivität des Systems, das "mit Möglichkeiten des Aufbaus von Eigenkomplexität autopoietischer Systeme (experimentiert), die freilich immer schon umweltangepaßt sein müssen, wie ein Beobachter feststellen kann..." (Luhmann 1990, S. 281).
Die Systemelemente sind bei ihm nicht Menschen, sondern Ereignisse. Die Menschen gehören zur Umwelt, sind nicht vom System "vereinnahmt" (Ihre spezifische Autonomie liegt deshalb außerhalb des Systems). In der Entwicklung entgeht er dem Problem, daß ein System nach einer wesentlichen Veränderung nicht mehr dasselbe ist, indem er jeweils die System-Umwelt-Differenz evolvieren läßt, die ja erhalten bleibt.
Simmel (nach Willke, S. 20) betont die Wechselwirkung von Differenzierung und Integration bei der Evolution. Besonders aktuell ist die Fragestellung nach dem Erhalt der bisher erreichten Komplexität der Gesellschaft in Form von Differenzierung und Arbeitsteilung und den Chancen der Weiterentwicklung. Rainer Land sieht die weitere Evolution eng mit der Innovationsimplementierung durch die Rolle des Geldes verbunden. R. Land war am Ende der DDR einer der ersten, die systemtheoretisches Wissen mit den damals akuten gesellschaftlichen Problemstellungen verbanden. Einer anderer Autor des damals entstandenen neuen Sozialismuskonzepts stellt auch fest, daß Entfremdung als Folge der notwendigen Ausdifferenzierung doch immer erhalten bleiben wird (Brie 1991 S. 157/168). H.-P. Krüger stellt sich die Frage: "Welche Art von Ganzheit, die sich nicht wieder fetischartig und institutionell verselbständigt, ermöglicht eine Vielheit, die für alle produktiv wird?" (ebenda S.197) Als "Antwort" erinnert Brie an das "genossenschaftliche private Eigentum" nach Marx (Brie, S. 163). An dieser Stelle kann uns keine abstrakte Systemtheorie eine Antwort geben. Wir müssen die konkreten Wesenszüge der gesellschaftlichen Bereiche untersuchen.
Ausführlicher werde ich dies ausführen in dem zweiten Band meines Buches "Daß nichts bleibt, wie es ist...". Ich bin deshalb an Diskussionen dazu sehr interessiert. Literatur:
Bahro, R.: Rückkehr. Die In-Weltkrise als Ursprung der Weltzerstörung.Frankfurt a.M. 1991
(Atome und Gedanken) vergehen im Laufe der Zeit schneller, als MEIN Leben währt. Gibt's MICH also gar nicht? Bin ich nur ein Wirbel im Strom der fließenden Materie, der sich einbildet, etwas Eigenständiges zu sein? Oder ein Reiskorn im Brei - immerhin ein Korn, bis es zermatscht...
daß ich anders bin als alles andere auf der Welt. ICH bin der Unterschied.
Wenn ich das Anderssein satt habe, und so werde wie alle andern - bin ICH es nicht mehr...
oder in die fremde Erde wurzeln. Anders bleiben - aber Bindungen eingehen und dadurch Neues wachsen lassen.
siehe auch:
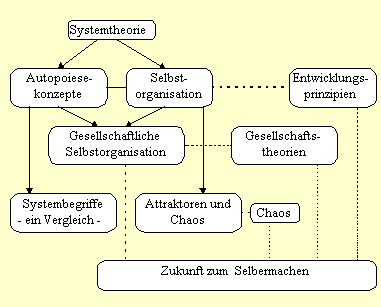
von Olaf Haarkamp und Bernd Porr Dort wird die "übliche" Systemtheorie verwendet, die aus anderen Wurzeln rührt als meine waren - aber es gibt durchaus Übereinstimmungen und Entsprechungen.
Weiterhin lesenswert:
|