|
Umfassende Bereiche:
Das Modell der Autopoiesis verdeutlicht viele Systemzusammenhänge,
die bisher zu wenig beleuchtet wurden. Es kennzeichnet spezielle
autonome Systeme, die besonders komplex sind. Deshalb weist es
auf Merkmale komplexer Systeme hin, die auch in anderen Bereichen
von Bedeutung sind. Die Anwendung auf die menschliche Gesellschaft
ist besonders aktuell und umstritten. Ich fasse einige Tendenzen
der Diskussion zusammen. Die Erkenntnis im Gehirn ist so ziemlich der komplexeste Prozeß, den wir im Universum kennen. Die Strukturiertheit gerade dieses Prozesses kann deshalb ein Modell für alle komplexen Systeme sein. Spezielle Aussagen aus der neueren Erkenntnistheorie wurden im Konzept der Autopoiese durch Varela und Maturana zusammengefaßt. Dazu gehören:
Dies stützt den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus. Diese Eigenschaften finden sich im übertragenen Sinne auch bei den Lebensprozessen wieder:
Zusammenfassend: "Es gibt eine Klasse von Systemen, bei denen jedes Element als eine zusammengesetzte Einheit (System), als ein Netzwerk der Produktion von Bestandteilen definiert, ist, die (a) durch ihre Interaktion rekursiv das Netzwerk der Produktionen bilden und verwirklichen, das sie selbst produziert hat; (b) die Grenzen des Netzwerks als Bestandteile konstituieren, die an seiner Konstitution und Realisierung teilnehmen; und
(c) das Netzwerk als eine zusammengesetzte Einheit in dem Raum konstitutieren und realisieren, in dem es existiert." (Maturana 1978)
Selbstreferentielle Autonomie wurde mit anderen Worten schon von Hegel betrachtet: "Das Individuum ist Beziehung auf sich dadurch, daß es allem anderen Grenzen setzt; aber diese Grenzen sind damit auch Grenzen seiner selbst; Beziehungen auf Anderes, es hat sein Dasein nicht in ihm selbst." In der Anwendung auf die Gesellschaft gibt es vielfältige Konzepte, hier unterscheiden sich auch Varela und Maturana deutlich voneinander: Varela will keine Anwendung der Autopoiesis auf die menschliche Gesellschaft. Die Gesellschaft ist bei ihm höchstens autonom, aber nicht autopoietisch ("es wäre sehr an den Haaren herbeigezogen, die sozialen Interaktionen als Produktion ihrer Komponenten zu bezeichnen"). Bei Maturana dagegen emergiert das autopoietische soziale System aus den Interaktivitäten der Teilnehmer.
Dieses Konzept entwickeln u.a. Luhmann und Hejl auf unterschiedliche Weise weiter. Viele komplexe, dynamische Systeme (als Wirklichkeitsbereiche mit für sie wesentlichen Zusammenhängen) im Nicht-Gleichgewicht sind: - selbstreferentiell geschlossen (weil sie ihre eigenen Systemoperationen definieren) und - selbsterzeugend (weil sie ihre eigenen Anfangs- und Randbedingungen erzeugen - dies gilt eigentlich nur für Zelle) und - autopoietisch (weil sie ihre eigenen Elemente erzeugen) und - selbstorganisierend (weil sie am Bifurkationspunkt spontan neue Zustände hervorbringen).
Die das System bildenden Elemente sind selbst auch Systeme und jedes System ist Element anderer, umfassender Systeme. Auf die Menschen angewendet bedeutet das:
Jeder einzelne Mensch ist selbstreferentiell geschlossen, selbsterzeugend, autopoietisch und selbstorganisierend und menschliche Gemeinschaften/Gesellschaften mit Systemcharakter (also Ganzheiten mit für sie typischen wesentlichen Zusammenhängen) sind selbstreferentiell geschlossen, selbsterzeugend, autopoietisch und selbstorganisierend.
Jede Verabsolutierung einzelner Aspekte führt zu falschen Globalaussagen. Einige Gefahren und Möglichkeiten seien kurz angedeutet: |
des Menschen |
der Gesellschaft |
||
| Reduktion auf biologisch-chemisch-kognitive Aspekte | Gesellschaft bleibt identisch, keine Entwicklung | Komplexographie (Niedersen) sensible Phasen der Individualentwicklung | |
| keine Entwicklungssprünge, keine Einbeziehung der Gesellschaft | Gesellschaftsapologetik (Luhmann) | Gesellschaft zumindest als gegebene Randbedingung | Gefahr, die menschlichen Individuen als Subjekte hinter den Systemgesetzen verschwinden. |
|
Ein etwas tiefergehender Vergleich der verschiedenen Konzepte wird im Anhang des zweiten Bandes meines Buches "Daß nichts bleibt, wie es ist..." erscheinen. Literatur:
Beurton, P., Werkzeugproduktion im Tierreich und menschliche Werkzeugproduktion, In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 12/1990
siehe auch:
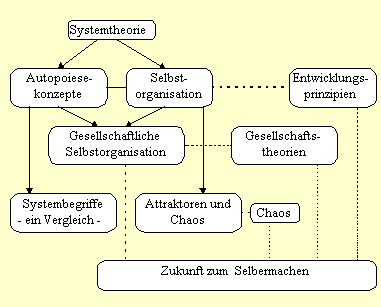
|