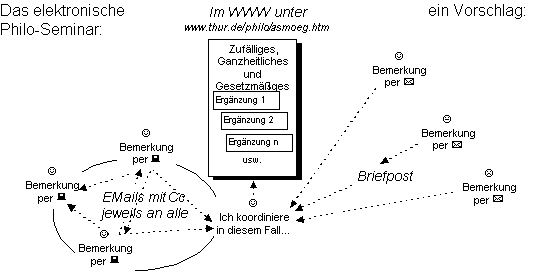
Umfassende Bereiche:
(This text is in English available)
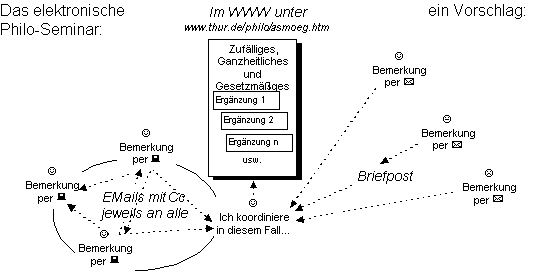
>
Durch die elektronische Vernetzung diskutieren jetzt oft Menschen
miteinander, die sich früher in den begrenzten (und selbst-referentiellen)
akademischen Zirkeln nicht begegnet wären. Dadurch stoßen
wir auf Begriffsunklarheiten, die wir klären müssen.
In einer Gruppendiskussion ging es letztens mit einem australischen
Marxisten um neue Aspekte für die politische Theorie aus
Selbstorganisationskonzepten. Ich erwähnte die Ergänzung
Hegelscher Dialektik durch "Möglichkeitfelder".
Sein Nachfragen veranlaßte mich, wieder in die Originalschriften
einzusteigen und einiges zu durchdenken.
Einige Begriffe wurden von der dialektisch-materialistischen
Philosophie (der DDR) entwickelt (wie die "ontologisierte"/materielle
Möglichkeit), die weltweit jetzt nicht vorausgesetzt und
auch nur schwer vermittelt werden können. Ich will nichts
wegwerfen, was sinnvoll ist - ich will aber auch nichts krampfhaft
beibehalten, was auch anders akzeptabel erklärbar sein kann
und vielleicht sogar neue Zusammenhänge sichtbar macht...
1. Es gibt keine Möglichkeiten - sondern Kontingenzen
Hegel kritisiert die Trägheit, die hinter der "Kategorie
der Möglichkeiten" steckt (Enz,I, §143 Zusatz).
Er unterscheidet den eindeutig nur abstrakt definierten Begriff
der Möglichkeit von dem der Zufälligkeit. Er führt
eine formelle Möglichkeit (ganz abstrakt: alles, was
sich nicht widerspricht) und eine reale (die von Bedingungen abhängig
ist) ein. Auch die "reale Möglichkeit" allerdings
entspricht nicht dem, was wir als Variantenvielfalt auf einem
Entwicklungsweg gern ausdrücken möchten. In der realen
Möglichkeit ist bei Hegel die Notwendigkeit enthalten,
weil real möglich nur das ist, dessen "Umstände
so sind", daß es notwendig wird. "Was daher real
möglich ist, das kann nicht mehr anders sein; unter diesen
Bedingungen und Umständen kann nicht etwas anderes erfolgen."
(WdL II, S, 211).
In Bezug auf das zeitliche Verhalten kennzeichnet das Mögliche
die "Tendenz zur Veränderung" (Hörz) und bringt
damit die Zukunft in das Gegenwärtige. Die Möglichkeit
in der Wirklichkeit macht das Wirkliche zu mehr als dem faktisch
Vorliegenden.
Dem Notwendigen gegenübergestellt ist nicht das Mögliche
(denn auch das Notwendige muß mindestens möglich sein),
sondern das Zufällige. Hier wird das Notwendige begrifflich
ausgeschlossen, weil es nicht die Reflektion-in-sich der Wirklichkeit
darstellt (wie die Möglichkeit). Das Zufällige verweist
auf die Reflektion-in-anderes. Es hat den Grund seines Seins nicht
in sich selbst, sondern in anderem (Enz.I, §145 Zusatz; Hörz,
Zufall S. 84).
Das Zufällige ist aber nicht lediglich "möglich-beliebig".
Es enthält einen inneren Widerspruch: Es existiert ohne Rücksicht
auf die Sache (Enz.I §148 ), enthält aber nichtsdestotrotz
die Bestimmungen der Sache (Enz.I §148 ). Oder anders ausgedrückt:
) Die Existenz ohne Rücksicht auf die Sache bringt einen
Überschuß an Umständen mit sich. Die konkrete
Sache und deren Bedingungsgesamtheit ist bestimmt/begrenzt - das
Zufällige trägt ein Mehr an Umständen an sie heran.
) Daß das Zufällige dem Inhalt der Sache gemäß
ist/seine Bestimmungen enthält, bedeutet, daß nur das
"Zufälliges" für die Sache wird, was überhaupt
für sie Bedeutung hat (was nicht auf die Sache wirkt, hat
gar keinen Bezug zu ihr, auch keinen "zufälligen".
Dies wird gegenwärtig z.B. neu formuliert in den Erkenntnissen
zur Selbst-Referenz der Wahrnehmung). (Vgl. auch: "Es ist
die Qualität des Etwas, dieser Äußerlichkeit preisgegeben
zu sein..." (WdL I, S. 133)).
Das Zufällige ist deshalb nicht nur ein "schlecht-vermittelt-Beliebiges...
sondern ein dialektisch-vermittelt-Unabgeschlossenes" (Bloch).
Deshalb trägt auch das Zufällige die Zukunft in sich.
Da sich im "neudeutschen" (soziologischen -vgl. Luhmann-
u.a.) Sprachgebrauch hierfür häufig der Begriff der
"Kontingenz" (Willke: Maß an Freiheitsgraden)
eingebürgert hat (und auch der philosophische Zufälligkeitsbegriff
mit der englischen contingency übersetzt wird), werde ich
ab jetzt für das Zufällige auch den Begriff Kontingenz
verwenden. Ihm kann man vielleicht im Deutschen die Beziehungshaftigkeit
zum Wesen der Sache () und damit die Zukunftshaltigkeit eher "anmerken"
als der "Zufälligkeit", von der wir im Sprachgefühl
zu viel Unvermitteltheit gewohnt sind. Englisch wäre noch
die Alternative "opportunity" sinnvoll.
Im Umgangssprachlichen kann man sicher bei den "Möglichen"
allgemein bleiben. Das "Kontingente" hat zu viel von
schicksalhaftem Zufall an sich. Es klingt besser, "Möglichkeiten"
gestalten zu wollen als "Kontingenzen".
In der DDR-Philosophie wurde wohl auch deshalb der Begriff der
Möglichkeit beibehalten und materialistisch interpretiert.
Diese "Ontologisierung" birgt meiner Meinung nach allerdings
die Gefahr, daß auch die "Wirklichkeit" mit ontologisiert
wird und dadurch das Faktische zum Normativen wird. In Blochs
ausdrucksstarker Sprache ist diese Gefahr umgangen: (Materie =
das "Nach-Möglichkeit-Seiende" und "In-Möglichkeit-Seiende").
Ich denke, im begrifflich exakten philosophischen Denken hat Hegels
Unterscheidung doch noch seine Berechtigung.
Die von Jost Cimutta schon 1967 auch für den "Zufall"
eingeforderte Begriffserweiterung: daß er auch als Funktions-
und Existenzbedingung selbstorganisierender Systeme erkannt werden
muß, ist hier enthalten. Niedersen betont die Rolle eines
"singulären Einzelnen" im Sprungpunkt bei der Bildung
neuer selbstorganisierter Strukturen.
Kontingenzen beruhen auf Beziehungen zwischen nicht durcheinander
begründeten Sachen. Das Nicht-durcheinander-Begründetsein
drückt ihren unabhängigen Teil aus, die Beziehungen
ihre Abhängigkeit.
Wesentlich ist auch die im Begriff der Kontingenz enthaltene Unmöglichkeit
der Trennung von Bedingungen und den Sachen. Die schon logisch
ausgeformte gegenseitige Beziehung wird in der Evolution zeitlich/historisch
zu einem wechselseitigen Übergang von Bedingungen in Inhalte
und umgekehrt. Oder anders gesprochen: der Übergang von äußeren
Bedingungen in innere Charakteristiken und der Übergang von
inneren Prozeßfolgen in äußere Umstände,
die wiederum zu äußeren Bedingungen der inneren Prozesse
werden, sind die Voraussetzungen für irreversible Veränderungen
im Inneren wie im Äußeren und damit die Historizität.
Evolution wird damit Ko-Evolution verschiedener Einheiten, die
sich wechselseitig Umstände und Bedingungen verändern...
Kontingenz beinhaltet dabei die Einheit von Offenheit durch den
Überschuß an Umständen (gegenüber der Gesamtheit
für ein Einzelnes) und tendenzieller Bestimmtheit durch das
Wirksamwerden relativer Bedingungsgesamtheiten durch die relative
Begrenztheit des Einzelnen/Bestimmten (nicht nur räumlich-energetisch,
sondern vor allem in nichtlinearen, positiven Prozeßrückkopplungen.
)
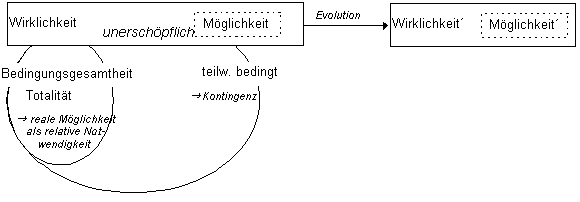
Was wir bisher oft als "Möglichkeit" bezeichnet
haben (das Noch-Nicht-Seiende: bei Aristoteles), meint also eher
die Kontingenz. Das "Anthropische Prinzip" stellt die kosmologische Frage, wieso einige physikalische Parameter in unserem Universum genau die Größe haben, die eine Lebens-entstehung im Universum ermöglichen. Bei anderen Parametergrößen wären zumindest unsere Lebensformen unmöglich. Jedoch hat das Leben bei der Entstehung der Parameter noch nicht existiert, es kann also auch nicht "zurückgewirkt" haben. Ich denke, daß wir uns hier täuschen lassen. Aus der Vergangenheit sieht alles aus, als wären die Umstände, die zu etwas Gegenwärtigem geführt haben, total zufällig gewesen (wenn mein potentieller Großvater nicht zu diesem einen Dorftanz gegangen wäre, wo er meine Großmutter kennengelernt hat...). Es war ja auch total zufällig (nicht durcheinander begründet). Aber es lag in ihrer Bestimmung, zusammenzupassen (nachdem sie sich einmal getroffen hatten). Als sie sich dann trafen, kamen alle Umstände zusammen, die ihre gemeinsame Zukunft notwendig machten. Wenn sie nicht ausgereicht hätten, wäre es anders gekommen... Aus den historisch entstandenen Umständen in unserem Universum können wir nicht auf ein anderes mit anderer Geschichte schließen, daß es dann "keine" für Evolution geeigneten Strukturen gegeben hätte. Im Universum konfigurieren sich Stoff-Energie-Strukturen durch ihre Wechselwirkungen. Jedes Wechselwirken führt "Zusammenpassendes" zusammen und führt zu neuen Offenheiten. Denkbare oder (vielleicht in anderen Universen reale) andere Kontingenzen würden zu anderen Strukturen führen - die andersartige Wechselwirkungen mit sich bringen würden und andere Formen des "Zusammenpassens". Die Ergebnisse würden sich vielleicht auch fragen, wie ausgerechnet sie entstehen konnten... (Dabei muß natürlich nicht jede Konstellation zu intelligenten Lebensformen führen, in einem solchen Universum fragt dann bloß keiner danach.).
Unsere Sicht ist ja extrem anthropozentrisch. Auch wenn die stoffliche
Materie nach dem Urknall so weit "auseinandergestiebt"
wäre, daß zwischen den einzelnen Elementarteilchen
keine Kern- und elektrischen Kräfte wirken - so hätte
die Gravitationskraft mit ihrer unendlichen Reichweite doch Auswirkungen.
Über das Quantenvakuum können wir an dieser Stelle sowieso
noch keine sicheren Aussagen machen.
2. Ganzheiten
Beim Quantenvakuum kommen wir gleich auf ein anderes Thema. In
Bezug zur Quantentheorie werden sog. "nicht-lokale"
Quanten-Wechselwirkungen diskutiert.
Abgesehen vom unklaren Status der Interpretationen (eigentlich
wird nur nachgewiesen, daß es keine sog. "verborgenen
Parameter" gibt, daß die Quantenobjekte tatsächlich
nicht den klassischen Begriffen wie "Bahn" entsprechen)
wird damit oft verbunden, daß das Universum somit endgültig
als eine große Ganzheit aufzufassen sei. Gegenüber
dieser "All-Ganzheit" seien alle anderen Dinge/Prozesse
nur Teile/Elemente. Charakteristisch für diese Teile ist
in dieser Interpretation nicht eine wesensbezogene gegenseitige
Abgrenzung, sondern im Gegenteil ihre Gleichartigkeit in Bezug
auf das Ganze. Diese Gleichartigkeit bezieht sich z.B. auf ihr
vereinigtes Sein als Verdichtungen im unendlichen Netz der Energieschwingungen
im Quantenvakuum... In einer Mailingdiskussion wird Ervin Laszlo zitiert, wonach man in der Vakuum-Energie einen "inneren Raum" gefunden haben will, der beim Urknall nicht zerstört wird, der von Universum zu Universum erhalten bleibt und alles "aufzeichnet", was passiert. Die ominöse Synchronizität ist ein Beispiel dafür. (mail von Tom vom 11.4.). Auf diese Weise braucht man sich nicht mehr als Verehrer einer "Übernatürlichkeit" kritisieren zu lassen, sondern "das Natürliche ist übernatürlich genug".
Dieses Energiefeld wird dann oft als "Bewußtseins-"
oder "Geist"-Feld uminterpretiert ... Mich erinnerte diese Sichtweise sofort an Schelling. Auch Schelling wird häufig herangezogen als Vordenker eines ökologisch-ganzheitlichen Denkens. Bei Schelling ist das Wirkliche auf die Existenz in einer bestimmten Zeit bezogen (das, was ist), das Mögliche auf das Dasein in der Zeit überhaupt - aber das von ihm in den Mittelpunkt gestellte Absolute, Identische vereint Wirklichkeit und Möglichkeit in der Notwendigkeit, die außer aller Zeit liegt. Gegenüber diesem Absoluten ist alles Zeitliche unwichtig, unerheblich -denn im Absoluten ist alles Mögliche enthalten. Was in dieser Zeit und in diesem Leben nicht klappt, ist nicht zu bedauern oder etwas Gewolltes anzustreben, denn im zeitlos-ewigen Absoluten ist sowieso alles vorhanden. "Was bestehen soll, besteht, und was vergehen soll, vergeht; an beidem kann nichts verhindert oder hinzugethan werden... Wozu also alle Sorgen und das unruhige Streben? Was geschehen soll, geschieht doch" (1804, S. 579). Genauso beruhigt uns ein Text im Internet über "Ganzheitlichkeit und Erleuchtung" (T.Murphy). "Wie alles Sein entwickeln wir uns in der besten Weise, die uns möglich ist"... "Wir brauchen uns nicht länger sorgen, oder denken, oder reflektieren, oder erinnern .- weil wir hier und jetzt genau das Richtige, unser Bestes tun..."
Eine wahrhafte Berechtigung haben diese Tröstungen gegenüber
hektischem Aktivismus (vgl. Yoga). "Wenn Entscheidungen zu treffen sind,
kann keine Sorge oder Anstrengung unsere beste Einsicht verbessern..."
Dieser Satz aus einem Zitat in dem o.g. Text verweist auf die
Notwendigkeit von Gelassenenheit. Leider wird das unter der Hand
oft in Richtung Sorglosigkeit oder gar Verantwortungslosigkeit
(Du kannst eh nichts machen) uminterpretiert. Die Tautologie "Du
machst, was du machst" besagt, daß du genau mit der
Anstrengung, Sorge, Verantwortung, die du auf dich nimmst, handelst.
Nicht, daß eh alles nichts nützt.
Im Kern wird dann realisiert, was im Grundgedanken des Einen Ganzen
steckt. Wenn es ein größtes Ganzes gibt - erfüllt
dieses die absolute Bedingungsgesamtheit für alles, enthüllt
alle Kontingenzen als nur scheinbar, weil aus mangelnder Einsicht
in das Große, Ganze herrührend. Auch für Hegel gibt es nur ein Absolutes, dessen Totalität als Ergebnis aller Widersprüche in den endlichen Zwischenstufen entsteht und das bereits vorher treibend wirkt. Freiheit bleibt deshalb auch bei Hegel lediglich eine "freie" Einsicht in die Notwendigkeit der Entwicklung hin zum Absoluten. Wenn Friedrich Engels dies korrigiert als "Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können", so kann auch hier hineininterpretiert werden, daß vollständige Sachkenntnis zu vollständig bestimmten notwendig-richtigen Entscheidungen führen würde.
Ken Wilbers "Spirit" wirkt ebenfalls als treibender
Geist in allem und stellt im gleichen Gedankengang das Ergebnis
aller Evolution dar. Für ein "richtiges Leben",
für das die Philosophie eine Orientierung geben soll, ergibt
sich ein Einmünden in spirituelle Heilslehren (die stolz
auf ihre Toleranz sind, da sie alle dieses gleiche Grundprinzip
haben). Wir haben uns nicht auf das Schöpfen neuer Entwicklungswege
in der endlichen Welt, auf das Treffen geeigneter Entscheidungen,
auf das Entwickeln eigener, neuer Werte zu konzentrieren - sondern
einfach nur das nachzufühlen, zu empfinden, zu leben, was
"der Spirit" von uns will. Die "spirituelle Odyssey"
jedes Einzelnen hin zum Spirit rettet die Welt...
Wir sollten dabei nicht vergessen, worauf sich die moderne Ganzheitlichkeitslehre
in ihrer Verabsolutierung (und nur diese kritisiere ich) bezieht:
Das Ganze wird demnach durch ein Geflecht energetischer nicht-lokaler
Quantenwechselwirkungen konstituiert. Mein Sein ist deshalb nicht
als Mensch wichtig, sondern meine Elementarteilchen schwingen
im Takt des Quantenvakuums. Nur dies ist die beschworene Einheit.
Dabei ist es völlig gleichgültig, was ich tue und ob
ich etwas tue. Ob ich lebe, oder ob meine Atome längst zu
Staub und Vakuumquanten zerfallen sind... Ist das die Ethik der
Ganzheitlichkeits-Ökologie?
Diese Art ganzheitlicher Weltanschauung ist entstanden in dem
Bemühen, das Herrschaftsverhältnis der Menschen gegenüber
der Natur zu kritisieren. Herrschaft wird mit Hierarchie verbunden.
Die tieferen Ursachen für das reale Herrschaftsverhältnis
werden in einem falschen Verständnis der wirklichen Beziehungen
gesehen und die "wirklichen" haben ganzheitlich zu sein
um ökologisch sein zu können.
In einer reinen Gegenüberstellung wird der Herrschafts-Hierarchie
ein Einheits-"brei" gegenübergestellt, in der den
Teilen keine wesentlich unterschiedlichen Qualitäten mehr
zuerkannt werden. Ken Wilber predigt "Keine Grenzen"
und stellt seine frühere Unterscheidung von "Fusion"
(im Einheitsbrei) und "Integration" (mit differenzierten
Teilen) in den Hintergrund.
In der verabsolutierten Ganzheitlichkeitssicht (All-Ganzheit gegenüber
gleichartigen Teilen) gibt es keine Entwicklung - es sei denn
als "Auswicklung" eines schon immer ("außer
aller Zeit" würde Schelling sagen) Vorhandenen.
Ich glaube, wir haben es mit einem typischen Pendeleffekt zu tun.
Tatsächlich wirken sich die Trennungen, Isolationen, undurchlässige
Grenzziehungen von Teilbereichen in der Realität ökologisch
und humanistisch verheerend aus. Als Gegenreaktion wird das Ganzheitliche
überbetont. Eine Zurückgewinnung des Individuell-Spezifischen
muß die Ganzheitlichkeit integrieren, nicht lediglich zurückweisen.
Wir haben dafür geeignete Denkmuster, die im Begriff des
"Wesens" liegen. Hegel hat uns diese Denkkategorie bereitgestellt,
obwohl er sie im "Begriff" aufgehoben sehen wollte.
Im Wesen nehmen wir die All-Ganzheit so weit zurück, daß in endlichen Existenzbereichen die Widersprüche noch zu lösen sind. Das Lösen von Widersprüchen begründet die Existenz von Sachen, wobei diese wieder Widersprüche enthalten, die andere Sachen begründen usw.
Diese "Sachen" sind in sich ganzheitliche Dinge/Prozesse.
Sie werden konstituiert durch wesentliche (d.h. sie begründende)
Wechselwirkungen zwischen ihren Momenten/Elementen/Teilen (die
nur in den seltensten Fällen als stoffliche Körperchen
vorzustellen sind!).
Es gibt in jedem Ganzen Momente, die nicht beziehungslos, isoliert
nebeneinander bestehen, sondern unterschiedlich sind, einander
entgegengesetzt sind, einander als Momente enthalten - d.h. dialektisch
widersprüchlich sind.
Im widersprüchlichen Prozeß rückbezüglicher
Wechselwirkungen der spezifischen Momente wird ein Ganzes konstituiert.
Kontingenzen sind objektive Spielräume der Gegenwart, die
eine andere Zukunft ermöglichen. Wenn das Gegenwärtige
sich verändert hat, hat es sich entsprechend der Gesamtheit
der Bedingungen verändert. Die Gesamtheit entsteht aber erst
beim "Gerinnen des Möglichen zum Faktischen in der Gegenwart
(Dürr, S. 80). Das Wesen drückt sich dann aus in der
Qualität als Bestimmtheit eines unmittelbaren, seienden
Teils der Realität (WdLI,118).
Auch wenn es immer auch übergreifende Wechselwirkungen gibt
und kein Ganzes völlig isoliert ist - jedes Ganze ist selbst
ein Individuelles. Erst die Individualität jedes einzelnen
Ganzen führt dazu, daß sie wieder als Momente eines
widersprüchlich prozessuierenden umfassenderen Ganzen wirken
können. Einfacher ausgedrückt: es gibt nur Wechselbeziehungen,
wenn die Teile nicht unterschiedlos nebeneinander bestehen, sondern
wenn sie etwa auszutauschen haben. Und das haben sie nur, wenn
sie mindestens unterschiedlich sind. Die Unterschiedlichkeit könnte
noch neutral nebeneinanderbestehen. Erst in einem widersprüchlichen
Verhältnis - daß der eine braucht, was der andere hat
und umgekehrt - wird eine Ganzheitlichkeit stiftende Wechselbeziehung
daraus.
Auf diese Weise gelangen wir allerdings zu einer "vertikalen"
Strukturierung des Seins. Teile bilden Ganze, die auf ihrem Niveau
wieder Teile umfassenderer Ganzer sind. Genau dies wollte das
Ganzheitlichkeitskonzept doch verhindern!?
Wir müssen genau hinsehen, was die Begriffe ausdrücken.
Hierarchie im gesellschaftlichen Machtkontext ist keine Ganzheitlichkeitsbeziehung.
Im Bereich der Organismen z.B. wird die Hierarchie deshalb oft
"Heterarchie" genannt, weil der Machtaspekt ausschaltet
ist. Aber gerade in der Biologie wird die Individualität
als wichtigste Charakterisierung des Lebendigen hervorgehoben.
Einmal in Form der einzelnen Organismen, aber in Bezug auf Evolution
auch der Populationen, schließlich der wesentlich voneinander
unterschiedenen Arten usw. Die Biologie ist deshalb ein gutes
Beispiel für eine Ko-Evolution von jeweiligen Ganzen auf
unterschiedlichen Niveaus ohne den Aspekt der Herrschaft hineinbringen
zu müssen. Das in Form von Organismen organisierte biotische
Sein ist auch nur eine der Niveaustufen. Üblicherweise wird
das physi(kali)sche, biotische, gesellschaftliche (ökonomisch,
sozial, kulturell) und meist dann auch noch das psychische, seelische
und geistige Niveau unterschieden.
Da das Ganzheitliche in Form spezifischer Wesensunterschiede auf
verschiedenen Niveaus vorkommt und ein "umfassenderes Ganzes
gegenüber einem anderen Ganzen" sprachlich nicht günstig
ist, definieren wir für ein Ganzes den Begriff "System".
Es enthält die diskutierten Aspekte der Ganzheitlichkeit
und meint keinen lediglich quantitativ bestimmten "Variablenhalter",
sondern ist qualitativ bestimmt.
Das spezifische Wesen eines einzelnen Systems ist eng verbunden
mit seinem spezifischen (!) Betrag für das jeweils umfassenderere
System. Trotzdem liegt der Kern des Wesens in der Bestimmung des
Einzelnen (seinen spezifischen inneren Wechselwirkungen), wird
nicht durch die Wechselwirkungen nach außen erzeugt.
3. Gesetzmäßigkeiten
Ob wir "System", "Wesen" oder "Gesetz"
definieren -die Definition wird typisch hegelianisch zirkulär.
Das Gesetz kennzeichnet wesentliche Zusammenhänge zwischen
Momenten/Elementen in einem Ganzen (System). Dies berührt
Eigenschaften und Verhalten (Prozesse) der Elemente und des Ganzen
in ihrem wesentlichen, das Ganze begründenden Wechselverhältnis.
Das "Gesetzesproblem" ist deshalb ein "Ganzheitlichkeitsproblem"
und umgekehrt.
Ganzes und Elemente sind dabei Wirkliche. Es darf nicht der Eindruck
erweckt werden, das Ganze sei das Wirkliche, die Elemente die
Möglichkeiten, die sich im Ganzen "verwirklichten"
(denn auch das Ganze "verwirklicht" sich nur über
die Beziehungen der Elemente). Im Gesetz wird nach Hegel die Mannigfaltigkeit als wesentliches Verhältnis erfaßt.
Hier berühren wir die Begriffe des Möglichen und Zufälligen.
1. Es ist ungünstig, vom "Verwirklichen" von Möglichkeiten zu sprechen. Wir vermischen dabei den formellen Bereich, in dem die Wirklichkeit Möglichkeiten "setzt" und diese sich in Wirklichkeiten "aufheben", mit dem Bereich des Realen als "Verwirklichung". Das hat nicht nur formale Bedeutung, sondern kennzeichnet unterschiedliche Inhalte: Beim "Verwirklichen von Möglichkeiten" erscheint die formale Folge: "Wirklichkeit - Möglichkeit - Wirklichkeit" real als Zeitabfolge. "Erst" gäbe es eine Wirklichkeit, "dann" haben wir eine Möglichkeit und "danach" realisiert sich diese zu einer neuen Möglichkeit. Dies würde für einen Existenzbegriff zutreffen, nicht für die Wirklichkeit, welche die Möglichkeit als ihr abstraktes Moment enthält ("außer aller Zeit" würde Schelling betonen). (Ich wurde von meinen Mailpartnern auf die entsprechende Hegelstelle - Enzyklopädie §143 Zusatz - verwiesen.)
Als Abstraktes kennzeichnet die Möglichkeit auch nicht das,
was wir meinen, wenn wir über Veränderungen realer Objekte
sprechen.
Natürlich kann man nun einen anderen Möglichkeitsbegriff,
z.B. einen "dialektisch-materialistischen" (wie bei
Elke Uhl) definieren. Das führt zu der Gefahr, daß
die "ontologisierte" Wirklichkeit auf das Vorhandene/
Faktische reduziert wird und genau das "Mehr" verlorengeht.
(Die "Möglichkeit" kann dieses "Mehr"
nicht sein, siehe Hegel in Enz., § 143 Zusatz).
2. Elemente und Ganze sind gegen andere bestimmt und gegeneinander
unterschieden. Wenn wir sie als durch ihre Wechselwirkung bestimmt
betrachten, muß eine typische (die Wechselseitigkeit erfassende)
Charakterisierung erfolgen.
Deshalb schlage ich 1. vor, die Hegelsche Unterscheidung zwischen
Möglichkeit und Zufälligkeit (ab jetzt neudeutsch Kontingenz
genannt) zu berücksichtigen. Wenn wir die Vielfalt des Elementverhaltens betonen, sprechen wir von Kontingenz und Kontingenzfeld (wie wollen ja nicht das abstrakt Mögliche in seiner ganzen Leerheit betrachten). In Bezug auf umfassendere System hat auch das System Kontingenzen. In Bezug auf seine Teile dagegen ist es dadurch definiert, daß es umfassende Bedingungsgesamtheiten realisiert und deshalb die "reale Möglichkeit" als notwendige Tendenz des Systemverhaltens zeigt.
(Das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit ist
nichtsdestotrotz auch ein widersprüchliches. Die Wirklichkeit
setzt ein "Möglichkeitsfeld", d.h. eine widersprüchliche
Einheit des Möglichen und seiner Anderen - welches sich in
einer neuen Wirklichkeit aufhebt. Auf dieser Ebene bleiben jedoch
Zufälle und Bedingungen unberücksichtigt, weil nur die
Reflexion-in-sich betrachtet wird, also die reale Möglichkeit
sich als Notwendigkeit erweist.)
3. Die Vermischung der Kategorien Wirklichkeit-Zufälligkeit
und System-Element kann zu Unklarheiten führen: a) "Das Gesetz gibt eine Skala von Möglichkeiten, von denen zwar eine notwendig verwirklicht wird, aber welche das sein wird, ist (bezogen auf das Gesetz) bedingt zufällig." (Hörz, DZfPh 7/67)
Hier bleibt es unklar, wann die Möglichkeit(en) der Elemente
und wann diejenige des Systems gemeint sind. b) Der neuere Gesetzesbegriff unterscheidet deutlicher (Ms: Möglichkeit für das System und mn: Elementmöglichkeiten)
"Ein statistisches Gesetz ist ein allgemein-notwendiger und
wesentlicher Zusammenhang zwischen Elementen eines Systems, der
eine Möglichkeit für das Systemverhalten (Ms)
bestimmt, die als Tendenz notwendig verwirklicht wird (dynamischer
Aspekt) , wobei die Elemente aus einem Möglichkeitsfeld (mn)
bedingt zufällig Möglichkeiten entsprechend der Wahrscheinlichkeitsverteilung
(pn) verwirklichen (wn) (stochastischer
Aspekt) und der Übergang eines Elements von einem Zustand
in einen anderen mit einer bestimmten Übergangswahrscheinlichkeit
erfolgt (probabilistischer Aspekt)." (Hörz, Wessel,
S. 108).
Hier bleibt jetzt der Zusammenhang von tendenziell notwendigem
Systemverhalten und bedingt zufälligem Elementverhalten unabgeleitet
(der in a) noch angesprochen wird).
4. Unter Verwendung des Kontingenzbegriffes und der Zusammenhänge
in der inneren Struktur des Gesetzes könnte eine andere Fassung
so aussehen: Das Gesetz ist ein wesentlicher und allgemein-notwendiger Zusammenhang, der für das umfassende System seine reale Möglichkeit als Verhaltenstendenz und damit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die kontingenten Prozesse der Elemente notwendig bestimmt (dynamischer Aspekt),
wobei die enthaltenen Elemente/Momente
innerhalb ihres Kontingenzfeldes (stochastisch) widersprüchliche
wechselseitige Beziehungen und (probabilistische, d.h. bedingt
zufällige) Übergänge zwischen den kontingenten
Prozeßformen/ Zuständen innerhalb des umfassenden Systems
realisieren. Obwohl die Entwicklung insgesamt in gesetzmäßigen Zusammenhängen stattfindet, sagt kein Gesetz den Weg voraus. Ein Gesetz, wie oben definiert, kann immer nur bestimmte Kontingenzen mit Bedingungen verknüpfen. Außerdem ist nicht zu vergessen, daß vollständige Entwicklungssprünge (Integration mehrerer Systeme...) nicht durch wesentliche Zusammenhänge (Gesetze) eines Systems bedingt und bestimmt werden, sondern durch die Wechselwirkung mehrerer Systeme (Gesetze).
Deshalb lassen sich die faszinierenden Eigenschaften der Selbstorganisation
nicht bereits in den Gesetzesbegriff für je ein Systen hineindefinieren.
Dieser Begriff muß lediglich die Voraussetzungen dafür
enthalten (Kontingenzen für verschiedene Stadien der selbstorganisierten
Prozesse, Bedingtheiten usw.). Voraussetzung ist, daß das betrachtete System verschiedene Existenzniveaus (mit verschiedenem Wesen) umfaßt. (Das Wesen auf einem Niveau kann also gar nicht ohne die Wechselbeziehungen zwischen den Niveaus erfaßt werden). Dann enthält das sog. "umfassende System" sog. "Elemente" (die selbst für von ihnen umfaßte/ihn ihnen enthaltene Elemente umfassende Systeme darstellen Relativität). Das Element(/verhalten) konstituiert das System und das System konstituiert die ("äußeren") Umstände/Bedingungen für wesentliches Elementverhalten. Es ist für konkrete Systeme niemals vollständig, deshalb entstehen Kontingenzen mit (bedingten) Wahrscheinlichkeitsverteilungen ( Kontingenzfeld) für das Elementverhalten. Die Möglichkeit für das Elementverhalten ist notwendig durch dessen inneres Wesen bestimmt, nicht jedoch deren Kontingenzen, die für das umfassende System bedeutsam werden. Die Elemente verhalten sich (probabilistisch) bedingt zufällig entsprechend den Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Stochastik) ihres (zeitlich veränderlichen!) Kontingenzfeldes. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist notwendig bestimmt (weil das System die Bedingungen für das Ausschließen des Unmöglichen bereitstellt...)
Das umfassende System bleibt (in unserer Betrachtung) erhalten.
Seine weitere Existenz (Dynamik) entspricht notwendig den
eigenen (vollständig vorhandenen) Umständen/Bedingungen.
(In Bezug auf noch umfassendere Systeme sind die Umstände
nicht vollständig und es existieren wiederum Kontingenzen
!). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung kann sich mit (selbst- oder
von außen) veränderten Bedingungen ändern.
4. Freiheit? - Freiheit! In den oben kurz zitierten Passagen aus "Wholeness and Enlightenment" kommt eine Denkweise zum Ausdruck, die Hegel als "Gesinnung der Alten" durchaus zu schätzen weiß: "weil solches ist, so ist es, und wie es ist, so soll es auch sein." (EnzI,§147 Zusatz). Hegel sieht die Unfreiheit nicht in der Notwendigkeit, sondern in der Vorstellung eines Widerspruchs zwischen dem, was ist und dem was sein und geschehen soll. Erst der Widerspruch führt zu Unfreiheit, Schmerz und Leiden. Damit stimmt Hegel mit dem Autor von "Wholeness..." überein. Während letzterer aber diese widerspruchsvermeidende Denkweise hier und heute anempfiehlt, will Hegel durchaus nicht die zu einer "unendlichen Bedeutung" gelangte Subjektivität zurücknehmen. Subjektivität beinhaltet nicht willkürliche, partikuläre Inhalte, sondern ist "ihrer Wahrheit nach der Sache immanent und als hiermit unendliche Subjektivität die Wahrheit der Sache selbst" (EnzI,§147 Zusatz). Subjektivität ist also wenigstens selbst notwendig in dem Weg der Sache hin zum Absoluten.
Weil auch wir die Ursache des Zufälligen
beim Menschen in seiner Natürlichkeit begründet sehen
(bei Hegel ebenda), stimmen wir weiter mit Hegel überein.
Wir werten diese Zusammenhänge jedoch
anders. Bei Hegel scheint hier bereits das später entwickelte
,aber bereits enthaltene, Absolute hindurch (wie bei Wilber der
"Spirit"). Logisch wird tatsächlich aus späterer
Sicht alles, was wir getan haben, notwendig gewesen sein. Die
Umstände (einschließlich der psychischen...) waren
halt so, daß ich und alle anderen das gemacht haben (aus
späterer Sicht), was wir machen (Gegenwart) und machen werden
(in Zukunft noch vor dem Standpunkt der späteren Sicht).
Das stimmt schon so. Das ist einfach ein logischer Zirkelschluß.
Da aber die Entwicklung hier und jetzt real
stattfindet, sind meine Entscheidungen noch relativ offen. Mein
Wirkungsfeld ist nicht von einer vollständigen Bedingungsgesamtheit
festgelegt, obwohl die Kontingenzen (im Sinne von Freiheitsgraden)
bedingt sind durch historisch entstandenen Umstände einschl.
meines Wesen, meiner Qualität.
Damit ist der eine Schritt getan, indem die Möglichkeit der
Freiheit aus den allgemeinen Bestimmungen der Welt abgeleitet
wurde. Was den Menschen in diesem Rahmen zusätzlich durch seine Gesellschaftlichkeit und seine Bewußtheit auszeichnet, wird damit noch nicht ausgeschöpft (dazu siehe assoges2.htm).
Heinz v. Foerster betont dabei: "The complement to necessity
is not chance, it is choice! We can choos who we wish to become..."
B.Buchanan geht weiter und fordert die Möglichkeit (opportunity)
zur Schöpfung neuer Alternativen.
Allerdings muß diese ausgezeichnete Besonderheit real und
im Denken immer zurückgebunden sein an die allgemeinen Ko-Evolutions-Wechselwirkungen
(als ihrer Existenzgrundlage). Uns bleibt genügend zu tun. "Wir gestalten und verändern die Welt, indem wir ihre Möglichkeiten ändern" schreibt Robert Havemann (S. 72) und zitiert Laotse: "Man muß wirken auf das, was noch nicht da ist."
Wie und an welcher Stelle wir das können, deutet Herbert
Hörz an: Es geht um das aktive Einflußnehmen, das Schaffen
von Bedingungen (die nicht unmöglich sein dürfen) für
das Gewollte (1971, S. 23).
Der Dichter Volker Braun: "Die Schwierigkeiten des Eingreifens:
es muß sich den Tatsachen beugen und sie zugleich ändern.
Die Tatsachen deuten zwar Richtungen an, in die die Geschichte
verlaufen kann, aber erst unser Handeln oder Zögern gibt
den Ausschlag unter den Möglichkeiten und macht den wirklichen
Verlauf."
Literatur:
| ||
siehe auch: