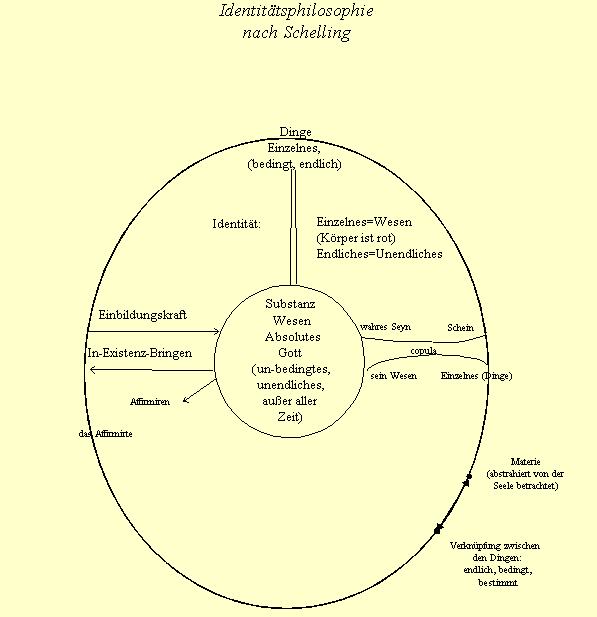die auf ihn wirken, zurückführen lassen." (Hölderlin) | 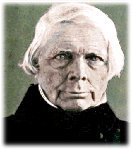 |
Die Philosophie des 1775 geborenen Schelling wurde geprägt
durch seine Herkunft aus der geistigen Welt der theologischen
Aufklärung und seine frühen Jugendjahren im Tübinger
Stift mit Hegel und Hölderlin. Diese Jahre waren durch den
Enthusiasmus der Französische Revolution gekennzeichnet (Dietzsch
1978, S. 13). Seine besonderen geistigen Fähigkeiten
ermöglichten schon früh ein eigenwilliges Denken.
Schelling wuchs direkt in den geistigen Umbruch hinein - der ältere
Fichte erlebte ihn noch selbst. Erst mit 28 Jahren las Fichte
Immanuel Kant, wodurch ihm eine völlig neue Denkweise eröffnet
wurde.
Vor Kant bedeutete wissenschaftliches Erkennen, daß die
Dinge und das Sein als notwendig nachgewiesen und erklärt
wurden. Für Freiheit blieb kein Raum. Kant fragte nun nach
den Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens und stellte
fest, daß die Erkenntnis der Naturkausalitäten (der
Nachweis der Notwendigkeiten) noch eine zweite Form der Kausalität
offen läßt: nämlich die Freiheit als Vermögen,
einen Zustand von selbst anzufangen. Er wies die Möglichkeit
nach, daß sich Freiheit und erkannte Naturnotwendigkeiten
nicht widersprechen. Allerdings zeigte er nicht, wie sie zusammengehörig
gedacht werden und realisiert sein können. Fichte
konnte jedoch befreit ausrufen:
Auch er begründete noch nicht vollständig, wieso Freiheit
positiv möglich ist. Er entschied sich gefühlsmäßig
dafür:
(Fichte 1799/1800)
Wenn aber nicht mehr alles in der Welt als notwendig erklärt
und nachgewiesen wird, so braucht man zum systematischen Denken
doch ein Festes, etwas Gewisses. Das einzige noch Gewisse angesichts
der Zweifel an allem sah Fichte im ICH.
Das ICH ist nicht einfach das (erfahrende, d.h. empirische) Ich-selbst
des einzelnen Menschen. Es bleibt nicht allein, sondern wirkt
nach außen, setzt ein Nicht-Ich. Da nun das ICH alles Äußere
selbst setzt, ist es befreit. Die Befreiung von dem Druck der
scheinbaren (vielleicht aber auch realen) Notwendigkeiten beschrieb
Fichte:
von Dingen unterdrückt zu werden, die deine eignen Produkte sind..." (Fichte 1799/1800)
Das ICH ist nicht ein untätig Betrachtendes, sondern im Setzen
des Nicht-ich ist es tätig. Das bedeutet:
Auch Schellings erste Schriften betonen ausdrücklich das
absolut freie Wesen des Menschen, aus dem das erste Prinzip seiner
Philosophie wird. (Schelling 1795a, 47)
Abstrakte Grundsätze an der Spitze dieser Wissenschaft sind der Tod alles Philosophierens." (Schelling 1996a,132)
Die dazu notwendige Revolution im philosophischen Denken beschrieb
er wie Fichte als Freilassung der Menschheit und ihrer Entziehung
vor den Schrecken einer objektiven Welt (Schelling
1795, 47).
Es ging also nicht mehr darum, im Sein etwas gegebenes Festes
zu finden.
So wichtig ein fester Standpunkt, eine Verankerung in Gesetzen
des Seins für eine handelnde Menschheit ist ("Wissen
ist Macht"), so fesselnd werden die Gesetze der Notwendigkeit
und sie werden deshalb abgeschüttelt.
Trotzdem blieben Fichte und Schelling nicht in der Abwehr des
alten Denkens stehen. Hölderlin als ehemaliger Stifts-Zimmergenosse
von Schelling ging einen anderen möglichen Weg. Er versuchte
nicht mehr, in der Erkenntnis und Vernunftanwendung neue Wege
zu gehen, sondern für ihn war die Welt nur noch dichterisch,
poetisch widerzuspiegeln und für sich erträglich zu
machen.
Schelling blieb dabei, daß es etwas Absolutes als einen
un-bedingten Grundsatz geben muß, in dem Philosophie neu
zu begründen ist. Philosophie unterscheidet sich dadurch
von anderen Wissenschaften, daß ihr Prinzip, ihr Grundsatz
durch nichts anderes mehr begründet und bedingt ist. Jede
Philosophie braucht also dieses Un-Bedingte.
Schellings Philosophie gründet sich auf das Credo:
Er konnte dies verbinden: Das Durch-nichts-Bedingte ist gleichzeitig
"das durch Freiheit Wirkliche" (ebenda,
S. 67). Was nun ist durch nichts bedingt und durch
Freiheit wirklich? Schelling fand diese Bestimmungen im ICH,
nicht dem einzelnen empirischen Ich-selbst, sondern im absoluten
Ich, ähnlich wie schon Fichte. Nur dieses ICH ist durch nichts
bedingt und kann durch nichts zum Objekt gemacht werden. Dies
ist nicht objektiv beweisbar, sondern Grundsatz und unhinterfragbarer
Grundsatz der Philosophie der Freiheit (vgl. Schelling
1796a, S. 132f.).
Die vorausgesetzte absolute Freiheit kommt allerdings nur einem
unbedingten, dem unendlichen, absoluten Ich zu, das später
von Schelling wie bei Spinoza "Substanz" genannt wird.
Das empirische Ich, der reale Mensch also, hat zwar Anteil an
diesem Unendlichen (sonst hätte es keine Vorstellung vom
unendlichen Ich), wird aber von etwas außer ihm Gesetzten,
nämlich von Objekten bestimmt.
Gegenüber einer ausweglosen Seins-Festlegung ist hier immer
noch sehr viel Platz für menschliches Streben:
Das absolute Ich ist also weder das empirische Ich-selbst, noch
ein Subjekt (denn ein solches ist bedingt durch das Objekt), sondern
gerade die Einheit ICH(Subjekt)=ICH(Objekt). Freiheit ist somit
auch keine "objektive Freiheit", weil das ICH gar kein
Objekt ist. Alles, was Objekt ist, ist bedingt und deshalb nicht
frei. Auch das Selbstbewußtsein ist für Schelling nicht
der höchste Begriff, sondern eher der Versuch des wandelbaren
empirischen Ich, seine Identität zu retten, die nicht zu
retten ist (Schelling 1795, 70).
Damals argumentierte Schelling auch noch ausdrücklich, daß
dieses oberste Prinzip "ICH BIN!" nicht mit Gott identifizierbar
sei (1806 sah er das anders).
Dieses Primat des Geistes ist lebenspraktisch für alle revolutionären
geistigen Vor-Entwürfe des Neuen, Zukünftigen unverzichtbar
:
Auch Hegel erwähnte die weltanschauliche Bedeutung der Befreiung
der Menschen von als "natürlich", d.h. unveränderbar
gesehenen Notwendigkeiten:
Der Geist soll frei und das, was er ist durch sich selbst sein." (Hegel 1830, S. 90)
Tatsächlich steht diese Philosophie gegen eine ohnmächtige
Anerkennung des Primats des So-Seins und wurde, wie oben beschrieben,
bewußt dagegen ausgearbeitet. Die tätige, schaffende
Rückbindung an die reale Welt forderte Schelling am Beispiels
des Lernens und Studierens:
(Schelling 1803)
|
|
(Statik herrscht vor)
Macht der Konzentration In-Dividuation
(gegen das Zerfließen im Ganzen)
Grund der Eigenexistenz
Gefahr: Egoismus
Zerstörung...
Gemeinschaft/ Liebe
Dynamik
Drang nach Bewegtheit, Sucht
ir-rationale Macht
Rehabilitation der Vitalität
(im Christentum)
Vernunft, Grenze, Maß, Ordnung und Form
(Anm.Fuhrmann zu Freih.-schr.,(1809) S. 155f.)
Bei Schelling ist es selbstverständlich, daß kein Prinzip
für sich etwas Schlechtes darstellt, daß alle Aspekte
vorhanden sein müssen. Erst das Übergewicht eines der
Prinzipien gefährdet den Bestand der Welt. Mit dieser einheitlichen
Sichtweise lassen sich deshalb heute alle einseitigen Weltanschauungen
kritisieren, die jeweils einen Pol zugunsten des anderen völlig
unterdrücken wollen (Anti-Rationalismus, Gemeinschaft ohne
Individualität).
Obwohl Schelling die Natur als lebendig erfaßt, ihre Produktivität
und Dynamik betont, ist seine Haltung zur Entwicklung widersprüchlich.
Die Zeit führte Schelling 1795 ein, um dem endlichen
Ich Gelegenheit zu geben, die Urform des Absoluten zu erreichen.
Diese Urform des Absoluten ist die Identität mit sich selbst.
Die Forderung "Sey absolut - identisch mit dir selbst"
(Schelling 1795, S. 89) verlangt ein Engagement im Sinne
des im Ich zum Ausdruck kommenden Freiheitsstrebens. Dahinter
steht die Idee eines möglichen und zu erreichenden Fortschritts.
Für das Leben des Einzelnen wird geraten:
Dieser Fortschritt läßt dem Handelnden selbst aber
keine Wahl mehr. Alles Mögliche ist schon fixiert, im Absoluten.
Dieses Absolute enthält die Verwirklichung alles Möglichen
(damit der unendlichen Freiheit). Im Absoluten ist alles Mögliche
wirklich. Das Mögliche ist deshalb gleichzeitig notwendig,
weil alles Verwirklichte letztlich notwendig ist. Die absolute
Freiheit ist identisch mit der Notwendigkeit. Es gibt keinen Raum
für zeitliche Prozesse mehr. Das Absolute ist außer
aller Zeit (aeternitas: Seyn in keiner Zeit), es ist nicht einmal
"ewig"(aeviternitas: Daseyn in aller Zeit)
(Schelling 1795, 92).
Der Ruf nach Freiheit wird also ein Aufruf zum Hineingehen in
die absolute Zeitlosigkeit.
In einem Text ein Jahr später stellte Schelling ausdrücklich
fest, daß es keine Philosophie der Geschichte geben könne.
In der Geschichte sei es unmöglich, die Richtung einer freien
Tätigkeit a priori zu bestimmen und dies sei nur ein Mangel
des Wissens, ein Ausdruck unserer Beschränktheit, "denn
hätten wir unsere Aufgabe erfüllt und das Absolute realisiert,
gäbe es auch für uns nur das Gesetz unsrer vollendeten
Natur" (Schelling 1796/97, 302/303).
Ausdrücklich betonte Schelling, daß es nur einen Schein
der Naturgeschichte und einen Schein der Freiheit gebe. Er unterscheidet
dann noch zwischen den tierischen Organismen und den Menschen
sowie jeweils zwischen Individuum und Gattung.
Den Tieren als Individuum kommt kein Progreß zu,
weil sie eingeschlossen sind in einen Zirkel von Handlungen, über
den sie nie hinaustreten.
Der Mensch als Individuum dagegen kann noch selbst Geschichte
machen (Schelling 1796/1797, 301).
Eine Geschichte der Tiergattungen ist in verschiedener
Weise denkbar:
a) Alle einzelnen Organisationen bezeichnen nur verschiedene Stufen
der Entwicklung einer und derselben Organisation.
b) Der jetzige Zustand der organischen Natur ist von dem ursprünglichen
höchst verschieden (Schelling 1796/1797, 299).
Im zweiten Falle wäre, wie Schelling bereits erkannte, die
Menge scheinbar verschiedener Arten auf Abartungen derselben Gattung
zurückführbar.
Schelling entschied sich hier für keine der Varianten, hob
aber hervor, daß in beiden Fällen eine Geschichte nur
für Gattungen angenommen werden kann, weil nur dann die Einheit
(Congruenz mit einem Ideal) in der Vielheit (Abweichungen im Einzelnen)
gesichert ist.
Geschichte ist überhaupt nur für Wesen, die den Charakter
einer Gattung ausdrücken, möglich. In diesem Sinne hat
das Menschengeschlecht als "Ein Ganzes" Geschichte (Schelling
1796/1797, 300). Diese Gattungsgeschichte hat jedoch ein
Ideal vor sich, wobei durch den Gattungscharakter bei allen Abweichungen
im Individuellen die Congruenz der Gattung mit diesem Ideal gesichert
ist.
Noch einige Jahre später betonte Schelling die unendliche
Entwicklungsfähigkeit jedes natürlichen Dings - aber
nur als Scheinprodukt, als noch nicht identisch mit dem Absoluten
(Schelling 1799b,335). Diese unendliche Entwicklungsfähigkeit
schließt durch die Bindung an das Absolute, wozu er später
auch Substanz und Gott sagen wird, jede Zufälligkeit aus
(Schelling 1799b,346/347 und Schelling 1804c, S.
383).
Ein echter dialektischer Entwicklungsgedanke verbirgt sich in
Schellings Darstellung vom Produkt als fixiertem Streit, als Gleichgewicht
entgegengesetzter Tätigkeiten. Da die Fortdauer des Gemeinschaftlichen
nur durch Konkurrenz beider Tätigkeiten realisiert wird,
kann sie nicht fortdauern und es entsteht Neues bis hin zur Intelligenz
mit dem ganzen System ihrer Vorstellungen (Schelling
1800,88). Dieser Gedanke wird aber nicht weiter verfolgt.
Er kommt auch einer Begründung der Historizität aus
der Selbst-Veränderung der Bedingungen (Nichtlinearität,
positive Rückkopplung) nahe:
"Es will nicht das Produkt, sondern in dem Produkt
sich selbst anschauen" - durch dieses Streben entsteht die
Bedingung eines neuen Produkts
und
"...daß alle dynamische Bewegung der Natur
aus Identität hervorquillt, daß sie aber eben deshalb
als ihre Bedingung ... Differenz fordert" (Schelling
1800,116 u. auch 1804c, 332).
Der Zeitbegriff enthält die Erkenntnis, daß Zeit
von Entwicklungsprozessen selbst abhängt. Sie entsteht ,
"damit das mit Bewußtsein empfindende ICH sich im Selbstgefühl
selbst zum Objekt werden kann"; Zeit ist das "ICH in
Tätigkeit gedacht" (Schelling 1800,125).
Die Stufenfolge der Sukzession der Intelligenz sah er als Höherentwicklung
in der Richtung: Pflanze Tier (GehörSehen...) (Schelling
1800,149). Damit war das geist(dynamik-)erfüllte Nicht-ich
noch die Voraussetzung für das menschliche Ich.
4 Jahre später jedoch drehte er die Richtung um. Er sah nur
noch eine "allmähliche Verschlechterung der Erde"
und eine "herabgesunkene Cultur". Er sah die Geister
von ihrem Centro abgefallen, wobei dieser Abfall als Mittel der
vollendeten Offenbarung Gottes dient. Die Natur war ihm nur noch
ein "verworrenes Scheinbild gefallener Geister", die
Seele bestimmt selbst den Ort ihrer Wiedergeburt in den natürlichen
Dingen und die Endabsicht der Geschichte ist die Versöhnung
des Abfalls (Schelling 1804a) .
Die unorganische Natur war ihm nicht mehr produktiv aus sich heraus,
sondern es gab für ihn keine unorganische Natur, diese war
ihm eine schlafende Tier- und Pflanzenwelt" (Schelling
1804c, 390f.).
Sehr schön legte er den Zusammenhang von Vergangenheit und
Zukunft dar:
Bestimmend in der Zeit ist die Zukunft, da alles Mögliche
letztlich im Absoluten vereint ist und das Zeitliche nur dahin
führt (Schelling 1804c, 285).
Das Prozeßhafte wird sofort wieder relativiert:
Die Statik der unendlichen Substanz (außer aller Zeit) war
also hier schon gedanklich enthalten, wenn auch erst 1906 noch
deutlicher ausgesprochen. Veränderung und damit Entwicklung
war für Schelling wesentlich nicht Thema der Philosophie:
Das Zeitleben ist ein nichtiges Leben (Schelling
1806b, 653):
"Es ist abermals Irrthum, wenn du das Entstehen
und Vergehen als solche zu sehen glaubst... und es ist nur Geistesträgheit,
wenn du die Zeit nicht als die Ewigkeit und die Ewigkeit nicht
als die Zeit zu sehen dir bewußt bist" (Schelling:
1806a, 623).
Die "Natur bleibt der Substanz nach immer dieselbe"
(Schelling 1806b S. 707) und im Wechsel der Formen "nimmt
das Höhere das Niedere in sich auf als ein zu seiner Existenz
Gehöriges" (Schelling 1806b, 702).
Schelling hat damit Abschied genommen vom Streben nach Fortschritt.
Mit dem Vorwurf, diese Welterziehung und Weltverbesserung zwinge
die Mannigfaltigkeit unter eine Formel, läßt er den
Gegebenheiten ihren Lauf:
"Die Mannichfaltigkeit der Schöpfung, hauptsächlich
wie sie sich im Menschengeschlecht geoffenbart hat, unter eine
Formel zwingen zu wollen, ist der größtmögliche
Wahn, aus dem statt der Heiterkeit und Ruhe der Betrachtung nur
Unlust und eitle Mühe, wie bei unsern eingebildeten Welterziehern
und Weltverbesserern entsteht, oder in verwirrter Verstandesphilosophie
die Anklage des Schöpfers, dessen unendliche Fülle sich
in allen Graden der Perfektion, ohne Einschränkung in irgend
einem, dargestellt hat, weil in jedem für sich die Unendlichkeit
ist"(Schelling 1806b, 678).
Schelling opferte damit die Freiheit, die doch noch 10 Jahre vorher
sein Ausgangspunkt war. Er stellte selbst eine Totalität
auf (das Absolute) und warf den "Weltverbesserern" vor,
die Welt unter eine Formel zwingen zu wollen. Lebensgeschichtlich
stand dahinter die Erfahrung der Napoleonischen "Freiheits"-Diktaturen.
Und er hat auch hiermit Recht: Gegenüber tatsächlich
aufgezwungener "Freiheit" ist das Recht auf Mannigfaltigkeit,
das Unendliche in jedem Einzelnen zu verteidigen.
1806 zog Schelling nach München. Er setzte sich in der 1809
erschienenen sog. Freiheitsschrift mit dem Vorwurf des Pantheismus
auseinander und verfeinerte die Bestimmung des Gottesbegriffs.
Es gelang es ihm dabei, das Böse als verträglich mit
seinem Gottesbegriff darzustellen. Obwohl er damit endgültig
auf Gott zurückkam, unterscheidet sich sein Gottesbild wesentlich
vom christlichen. Die Menschen sind der Welt nicht unterworfen,
sondern an sie ergeht der Auftrag Gottes, die Gefährdung
der Welt zu bestehen und sich darin zu bewähren.
Diese erneute Prozeßhaftigkeit in Schellings Denken mündet
in die Bemühungen, die "Weltalter" zu beschreiben,
was ihm nie vollständig gelingen wird.
Dietzsch, S.: F.W.J. Schelling, Leipzig/Jena/Berlin
1978
ab 1806
kontrahierendes Prinzip
expandierendes Prinzip
ab 1827
expandierendes Prinzip
kontrahierendes Prinzip
er kann und soll seine Geschichte sich selbst machen" (Schelling
1796/1797, 301).
"innerhalb der Natur kann aber jenes Verhältnis
zwar in Ansehung der einzelnen Dinge, aber es kann nie in Ansehung
der Natur selbst oder des Ganzen verändert werden.... Bei
dem Wechsel des Einzelnen bleibt das Ganze sich stets gleich."
(1804c, 291).
Fichte, J.G. (1794): Über die Würde
des Menschen, Leipzig 1976
Fichte, J.G. (1799/1800): Die Bestimmung des
Menschen, Leipzig 1976
Hegel, G.W.F. (1801): Differenz des Fichteschen
und Schellingschen Systems der Philosophie, Leipzig
1981
Hegel, G.W.F. (1830): Enzyklopädie der
phil. Wissenschaften I, S. 90, F.a.M. 1986
Schelling, F.W.J. (1795): Vom Ich als Princip
der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen
Wissen (in Ausgew.Schriften, F.a.M.
1985, Band 1)
Schelling F.W.J. (1796a): Antikritik zu: Vom
Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte
im menschlichen Wissen (1795a) (in Ausgew.Schriften,
F.a.M. 1985, Band 1)
Schelling F.W.J. (1796/97): Abhandlungen zur
Erläuterung des Idealismus in der Wissenschaftslehre
(in Ausgew.Schriften, F.a.M. 1985, Band 1)
Schelling F.W.J (1799a): Erster Entwurf eines
Systems der Naturphilosophie (in Ausgew.Schriften,
F.a.M. 1985, Band 1)
Schelling F.W.J. (1799b): Einleitung zu dem
Entwurf eines Systems der Naturphilosophie Oder über den
Begriff der speculativen Physik und die innere Organisation eines
Systems dieser Wissenschaft (in Ausgew.Schriften,
F.a.M. 1985, Band 1)
Schelling F.W.J. (1803): Vorlesungen über
die Methode des akademischen Studiums (in
Ausgew. Schriften, F.a.M. 1985, Band 2)
Schelling F.W.J. (1804a): Philosophie und
Religion (in Ausgew.Schriften, F.a.M. 1985,
Band 3)
Schelling F.W.J. (1804b):
Propädeutik der Philosophie (in
Ausgew.Schriften, F.a.M. 1985, Band 3)
Schelling F.W.J. (1804c): System der gesammten
Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere (in
Ausgew.Schriften, F.a.M. 1985, Band 3)
Schelling F.W.J. (1806a): Aus: Darlegung des
wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten
Fichteschen Lehre (in Ausgew.Schriften, F.a.M.
1985, Band 3)
Schelling F.W.J. (1806b): Aphorismen zur Einleitung
in die Naturphilosophie (in Ausgew.Schriften,
F.a.M. 1985, Band 3)
Schelling F.W.J. (1806c): (in
Ausgew.Schriften, F.a.M. 1985, Band 3)
Schelling F.W.J. (1809): Über das Wesen
der menschlichen Freiheit (Reclam, Stuttgart,
1964)
Schmied-Kowarzik W.: Zur Dialektik des Verhältnisses
von Mensch und Natur. Eine philosophiegeschichtliche Problemskizze
zu Kant und Schelling, in: Natur und geschichtlicher
Prozeß. Studien zur Naturphilosophie F.W.J.Schellings, Hrsg.
H.J.Sandkühler, Suhrkamp, FaM, 1984
siehe auch: