|
Umfassender Bereich:
einen Hund hinter dem Ofen hervorzulocken; das ist zwar vollkommen richtig, aber das ist auch nicht ihre Aufgabe. (Hegel)
Ich sitze über Büchern, ich lebe meinen Alltag, ich
treffe mich mit Freunden... manchmal sage ich dabei "Jetzt
mache ich Philosophie". Was ist das Besondere an diesen Gelegenheiten,
wo ich nicht nur ganz allgemein oder zu anderen Themen lese, lebe
und rede, sondern eben "philosophiere"?
Solange "Philosophie" als Universitätslehrfach
angesehen wird, können meine Alltagsmitmenschen damit nichts
anfangen und wollen auch nicht allzuviel damit zu tun haben. Wenn
wir dagegen über unsere Leben reden, kommen wir sehr schnell
ins "Philosophieren". Was ist also Philosophie? Einerseits wird damit ein inhaltlicher Bezug gekennzeichnet. Das Philosophieren benutzt andererseits einige typische Methoden. Solange wir so unter 20 Jahre alt sind, fragen wir uns, wohin wir unser Leben lenken sollen und ob wir überhaupt etwas lenken sollten. Im alltäglichen Leben vergeht uns das Philosophieren dann oft. Zwischendurch erziehen wir unsre Kinder - und machen uns Gedanken über deren Leben. Sie lenken wir auf jeden Fall in irgendeiner Weise. Auch wenn wirs nicht wollen, erleben sie unsere bewußte oder unbewußte "Lebensphilosophie" und werden sich dazu - ablehnend oder sie übernehmend - verhalten. Über uns selbst nachzudenken zwingt uns spätestens die Einsicht in die Endlichkeit unseres Lebens in der "midlife crisis" wieder. Wir bewerten unser gelebtes Leben und denken über den Rest unsrer Tage nach.
Wenn wir dieses "Nachdenken" methodisch gezielt durchführen,
kann das schon Philosophie sein. Die gewählten Methoden sind
oft unterschiedlich: Wir analysieren, assoziieren, synthetisieren,
abstrahieren, konkretisieren usw. Obwohl ich selbst in den von mir moderierten "Philosophischen Gesprächen" keinerlei Vorwissen oder wissenschaftliche Exaktheit voraussetze, sondern mich eher auf die oben erwähnten allgemeinen Lebensphilosophien und deren geistiger Verarbeitung stütze, möchte ich im folgenden den Philosophiebegriff doch stärker einschränken.
Denn auch diese allgemeinen Gespräche sollen nicht nur ein
folgenloses Gerede bleiben, sondern in sich eine Tendenz hin zu
stärkerer Stringenz und gedanklicher Vertiefung bzw. geistiger
Höhe enthalten. Das ist aber nur als Lernprozeß möglich,
bei dem jeder Teilnehmende nur so weit mitgeht, wie er es selbst
möchte. Ich habe keine akademischen Scheine zu vergeben,
aber ich hoffe, daß die Gespräche manchmal sogar stärker
in das gelebte Leben eindringen, als manches Theorieseminar.
Die Philosophie im engeren Sinne zeichnen bestimmte Merkmale aus. Dies sind unter anderem bezüglich des Inhalts:
Grundfragen jeder Philosophie sind in irgendeiner Form die nach
dem Verhältnis von Einem und dem Vielen, von Einheit der
Mannigfaltigkeiten als Ganzheiten. Das Zusammengehören dieser
Bestimmungen bringt Bewegung in das Denken; wie es sie auch in
der Realität mit sich bringt. Dadurch gerät nicht das
Sein als statisch Seiendes in den Mittelpunkt des Philosophierens,
sondern das sich Bewegende im Raum von vorhandenen oder gar neu
erzeugten Möglichkeiten. Philosophie kann die Realität
nicht nur abbilden, sondern im Namen der in ihr steckenden Möglichkeiten
auch kritisieren! Bezüglich der Form ist die Philosophie gekennzeichnet durch:
Typisch fürs philosophische Denken ist das Nachdenken übers
Denken. Nicht erst seit Kant - aber durch ihn explizit formuliert
- wird darüber nachgedacht, was der "Gegenstand"
unseres Erkennens eigentlich ist. Erkennen wir die Welt "an
sich", so wie sie ist - oder wird sie erst durch unsere Wahrnehmung
und unsere geistigen Prozesse "zurechtgemacht"; ehe
sie als "Gegenstand" dem denkenden Bewußtsein
zur Verfügung steht?
Modern gesprochen, existiert ja eine Selbstreferentialität.
Sogar bei der Sinnesempfindung empfinde ich ja nur physiologische
Prozesse in meinem Körper selbst. Ich nehme oft nur wahr,
was für mich als Signal wichtig ist, alles andere streift
mich nicht einmal. Beim Lernen kann ich auch nur dazulernen, was
mir "in den Kram" paßt, wofür ich vorbereitet
bin, was mich interessiert. Das "Verhältnis der Welt im Kopf zur Welt außer dem Kopf "(Schopenhauer) ist also keine Trivialität.
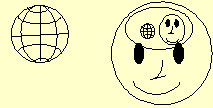
Indem wir in der Philosophie explizit die Bedingungen und Voraussetzungen
der Erkenntnis (allgemein und auch im Speziellen) hinterfragen,
beugt sich das Bewußtsein in sich zurück. Bei Hegel
ist der Verstand die einfache Reflexion. Erst die Reflexion über
die Reflexion ist das wahre, vernünftige Denken. Auch bei
Husserl ist das reflexive Bewußtsein wesentlich (als Epoché).
Diese Reflexion bezieht sich nicht nur aufs Nachdenken, auf die
Suche nach dem Wahren, sondern ebenso auf das Gute und Schöne.
Dieser Aspekt geht in unserer wissenschaftlich-technisch geprägten
Welt oft verloren (für uns als Menschen wie auch die Philosophie).
Das Motiv für dieses Nachdenken übers Denken ist aber
nicht nur erkenntnistheoretisches Interesse. Viel grundlegender
(und für die einzelnen Philosophen als Motiv oft nachgewiesen)
ist die praktische Fragestellung danach, wie der Mensch zur Welt
steht: Ist er nur ein unselbständiges Glied der Natur, das
selbst nichts entscheiden und bestimmen kann - oder hat er die
Freiheit, selbst zu entscheiden und Neues zu entwickeln?
Dies war für Schelling auch der eigentliche Hintergrund für seine Systematik, die kein statisches Sein sondern die Dynamik in den Mittelpunkt stellte:
Philosophiren über die Natur heißt, sie aus dem todten
Mechanismus, worin sie befangen erscheint, herauszuheben, sie
mit Freiheit gleichsam zu beleben und in eigne freie Entwicklung
versetzen..." (Schelling, 1799)
Bei Marx sind deswegen die Begriffe keine axiomatischen Definitionen,
wie wir sie aus der Mathematik kennen, sondern Verhältnisse.
Diese lassen sich nicht verdinglichen, sondern bleiben in Bewegung.
Die Aufgabe der Philosophie kann deshalb gesehen werden in:
Philosophie gibt "Antworten auf die Fragen nach dem Ursprung,
der Existenzweise und Entwicklung der Welt, nach der Quelle des
Wissens, nach der Stellung des Menschen in der Welt, nach dem
Sinn des Lebens und nach dem Charakter der gesellschaftlichen
Entwicklung" (Hörz 1995). Dabei ist Philosophie nicht
nur Abbild des Vorhandenen, sondern "befaßt sich mit
der Entstehung von qualitativ Neuem..." (Hörz 1984).
Obwohl ich all diese Bestimmungen eher nebeneinander gestellt
habe und nicht auseinander abgeleitet, stellen sie in ihren Grundgedanken
dar, was fast alle philosophierenden Menschen über Philosophie
meinen.
Eine wichtige Differenz in der möglichen Betrachtungsweise
möchte ich noch erwähnen: Wenn Philosophie als Sinnsuche, als Aufzeigen eines "letzten" Horizonts und dessen, was "hinter" der Erscheinungswelt liegt, betrachtet wird, versucht sie als Metaphysik die einzig wahre Philosophie zu sein. Alle Aussagen über Strukturzusammenhänge der Welt sind dann lediglich Wissenschaft und "negative" Philosophie. Diese Ansicht setzt ein Absolutes als Sinn-Ziel der Welt voraus und hält eine Dialektik, die nur aus dem Konkreten heraus wirken kann, für nichtphilosophisch. Deutlich wird das u.a. bei Schelling, für den es keine Entwicklungs-Philosophie geben kann, weil nur die "nichtigen" Dinge in der Zeit evolvieren. Bei Hegel, obwohl auch er mit dem Absoluten arbeitet, glaube ich ein anderes Konzept gefunden zu haben:
Bei ihm ist die Idee nicht ein außerweltliches Abstraktes,
sondern eine konkrete, geistige Wesenheit, die den Unterschied
in sich enthält. Bei ihm ist eine Identität immer das
Einheitliche und das Unterschiedene zugleich. Das Einheitliche
wird dem Differenzierten nicht entgegengestellt, sondern alles
identische ist eine Einheit von Differenzierten und alles Unterschiedene
ist unterschieden nur in Bezug auf ihre Identität. Das ist
aber immer nur im Konkreten möglich, weil nur als Konkrete
die Unterschiede ihre Widersprüchlichkeit und ihre Möglichkeiten
realisieren.
Die Philosophie beschäftigt sich zwar mit dem Allgemeinen,
aber in konkreten Begriffen, die sich bewegen, weil sie
ihren eigenen Gegensatz in sich haben.
Für die Welt gesprochen: sie besteht nur aus konkreten Prozessen
und Dingen, die ihre Widersprüchlichkeit in der Bewegung
und Entwicklung ausleben. (Es gibt real nicht "die Materie",
sondern nur Bereiche der Welt, die jeweils gleichzeitig Einheiten
von Mannigfaltigkeiten und Momente umfassenderer Einheiten
darstellen und sich deswegen bewegen und entwickeln.)
Sehen wir dies nicht, brauchen wir zur Begründung der Bewegung
und der Ganzheiten etwas Außerweltliches, Absolutes. Ich
persönlich meine hier, daß ich dies nicht brauche.
Deshalb ist alles, was ich mache, für manchen sicher überhaupt
keine Philosophie.
Wichtig ist jedoch die Unterscheidung von abstrakter Allgemeinheit
von konkreter Allgemeinheit - so haarspalterisch dies klingen
mag - für die Unterscheidung von
sog. Allgemein- oder Strukturwissenschaften wie Kybernetik oder
Synergetik oder Selbstorganisationskonzept von Philosophie. Ich binde den Philosophiebegriff nicht an das metaphysisch Absolute, weil das eine Form der Antwort auf die zugrundeliegende Frage nach dem Verhältnis von "Ich und der Welt" ist. Philosophie ist deshalb im allgemeineren Sinne das Nachdenken über sich und die Welt. Dabei ist für das Ich selbst eine Entwicklung zu betrachten (nach K.Wilber). Vom präpersonalen, von seiner Umwelt noch nicht unterschiedenem Ich (beim Baby und bei den ersten Urmenschengesellschaften) differenziert sich das Ich als personales heraus. Dieses Ich kann im Extremfall (fast) total in Isolation zu seiner Umwelt geraten und in Klassengesellschaften auch zu seinen Mitmenschen und deshalb total als isoliert reflektiert werden. Fichtes "Ich bin Ich!" betonte die Eigenständigkeit des Ich gegenüber der sonst fesselnden Naturgewalt und -gesetzlichkeit. Dies fördert das Selbstbewußtsein (Freiheitsproblem!), kann aber auch verhängnisvolle naturzerstörerische Lebensweisen begünstigen. Der nächste Schritt, den die über den bloß isolierenden, abstrahierenden Verstand hinausgehenden menschliche Vernunft gehen muß, ist das Verständnis der nicht hintergehbaren Dialektik von Einheit und Differenzierung von Mensch und Welt. Diese sog. transpersonale Ebene füllt Ken Wilber mit fast rein geistigen Prozessen aus - an anderer Stelle ( "A Brief History...") betont aber Wilber selbst, daß andere Ebenen wie das Soziale (Wirtschaft, Kommunikation) und Kulturelle genauso wichtig sind, wie die individuelle und kollektive Geistigkeit.
Die Welt selbst ist auch in Bewegung. So richtig spannend wird
es dann, (und nur so ist es seit Existenz der Menschheit auch
real), wenn sich Mensch und Welt gemeinsam entwickeln. Sie sind
nicht in absoluter Harmonie verbunden, sondern ihre Bestimmungen
sind auch gegensätzlicher Art. Das Integrieren des Gegensätzlichen
in immer neuen Stufen der Evolution ist das Faszinierende und
als philosophisches Thema sicher ewig. Jeder Mensch lebt einen
Teil dieses Geschehens mit. Er entwickelt sich und gestaltet Welt
- je mehr er dies überlegt, mit Vernunft tut, desto größer
ist die Chance, daß die Welt auch gut und schön wird.
der nicht denkt, eben weil das Denken dem Menschen als solchem eigen ist... (Antonio Gramsci) Literatur (nur eine kleine Auswahl):
Bloch, E.: Was ist Philosophie als suchend und versucherisch?
(1955), In: Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie,
Gesamtausgabe Band 10
Bloch, E.: Tendenz-Latenz-Utopie siehe auch:
|