|
Umfassender Bereich:
Sofie aus Gaarders Buch lernt, daß das Nachdenken über sich und die Welt ein Problem macht: In ihrem Kopf stecken plötzlich nochmal sie und die Welt. Sie gibt es plötzlich zweimal: Einmal als reales Mädchen
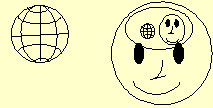
Sie ist es, die nachdenkt: Sofie oder Franziska oder Katja
oder Hanka oder Paulina... und keine andere, kein anderer.
Was macht eigentlich "sie selbst" aus?
Die heute übliche Philosophie - also
das Nachdenken über sich und die Welt - beginnt in den meisten
Darstellungen bei den alten Griechen, so auch in den Briefen,
die Sofie in Gaardners Buch erhält. Vorher sind "bloß"
Mythen. Da erzählt Gaarder auch einige aus seiner Heimat.
Aber er lenkt dann sofort um nach Griechenland. Erst das, was
hier entsteht, ist für ihn Philosophie.
Nun, uns ist es ziemlich egal, was wer wie nennt. Die Fragen,
die wir wirklich haben, sind andere. F. fragte z.B. letztens:
"Sollten wir uns unserer Umwelt anpassen oder uns eine Umwelt
suchen, die zu uns paßt?" Ich will nicht zu viel in
diese Frage hineininterpretieren, aber ich habe die Ahnung, daß
dahinter steckt, sich selbst und die eigenen Möglichkeiten
in der Welt kennenzulernen zu wollen.
Ich kann nun keine "richtige Antwort" angeben. Daß
ich das nicht kann, kann man auch theoretisch begründen,
muß hier aber nicht sein. Gut daran ist, daß es gar
nicht drauf ankommt, irgendetwas zu lernen oder viel zu lesen.
Wichtiger ist es, sein eigenes Leben zu leben - dabei aber
auch immer mal darüber nachzudenken, was eigentlich passiert
und dann daraus zu lernen. Und das immer wieder...
Dabei kann man natürlich von anderen lernen. Aber keine Lehrsätze
und Thesen, sondern mehr von der Art und Weise, wie die anderen
das so gemacht haben.
Da kann man dann bei den alten Griechen landen; man kann sich
auch genauer ansehen, wie die Entstehung einer neuen wirtschaftlichen
und politischen Freiheit in Europa vor 200 Jahren das Nachdenken
auf Grundlage eines neuen Selbstbewußtseins ("Ich bin
Ich!" - Fichte) beflügelte und dieses Selbstbewußtsein
wieder in politische Forderungen umschlug usw.
Eine andere Art, sich und die Welt zu sehen, zu fühlen
und zu denken, bietet die indische Tradition. Glücklicherweise
brauche ich keine "objektive, wahre" Abhandung über
diese Tradition schreiben, sondern kann das darstellen, was mir
wichtig war beim Kennenlernen. Einiges davon mag anderen, die
ähnliche Fragen bewegen, ähnlich wichtig sein können.
Deshalb schreibe ich es auf.
Seit ich einmal in der Woche zu einem Yoga-Kurs gehe, werde ich
von meinen Bekannten gefragt: "Und, was hat es gebracht?"
Ich muß dann immer lächeln. Manchen Fragestellern antworte
ich dann, daß Yoga gerade bedeutet, nicht sofort nach
einem "Effekt", einem direkten "Nutzen" zu
fragen.
Ein ganzheitliches Yoga beeinflußt nicht nur die Beweglichkeit
der Gelenke, die Körperhaltung und -dynamik - sondern erfaßt
das ganze Menschsein in seiner Einheit von Körper, Psyche,
Geist/Denken und seinen sozialen Bezügen.
Deshalb ist Yoga auch nicht eindeutig in die Schublade einer "Therapie"
oder einer "Philosophie" einzuordnen. Typisch dafür
ist gerade die Verwobenheit aller dieser menschlichen Aspekte,
das Nicht-Trennen von Körper und Geist, von Individuum und
Gemeinschaft.
Deutlich wird dies vielleicht an einigen konkreten Bemerkungen
zu den Übungsprinzipien des Yoga. Wir Westeuropäer sind in unserem Körpergefühl auf "Leistung" und "Effektivität" getrimmt. Die Eltern freuen sich über "Stärke" des Sprößlings, der Schulsport fördert Kraft, Schnelligkeit und Exaktheit. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir uns total auf dieses Ziel, spannen unseren ganzen Körper an... An den verbiesterten Gesichtern ist die Anstrengung meist nicht zu übersehen. Als ich zum erstenmal einem Marathonlauf zuschaute, erschrak ich fast vor diesen eigenartig verkrampften Masken, die die Läufer statt eines Gesichts zu haben schienen.
Auch im normalen Leben sitzen wir ständig "auf dem Sprung".
Die Hektik des Tages, der ständige Zwang, voll konzentriert
und dynamisch zu sein, sich nie "hängen zu lassen"
hält unseren Körper und den Geist ständig in einer
Alarmhaltung, die durch die Biologie eigentlich nur für wirkliche
Notsituationen vorgesehen war. Die körperlichen Reserven
werden nicht nur im Notfall angezapft, sondern ständig strapaziert.
Typische "Zivilisationskrankheiten" wie Bluthochdruck
entstehen. Wenn der Körper dann Alarmsignale seiner überlastung
aussendet - können wir nur noch gegen ihn kämpfen.
Mit chemischen Keulen oder auch mit psychischen Versuchen, irgendetwas
zwangsruhigzustellen (autogenes Training oder Yoga in diesem Sinne).
Ich bin nun keine Yoga-Expertin, aber schon die ersten Erfahrungen
damit zeigen mir die Möglichkeiten eines anderen Herangehens.
Einerseits sollte der Umgang mit dem eigenen Körper/Bewußtsein
anders gestaltet werden. Wichtiger ist aber andererseits die Praktizierung
eines anderen Lebensstils, in den der andere Körper/Bewußtseinsumgang
lediglich eingebettet ist.
Körper und Geist
Ich beginne trotzdem mit dem Körper/Bewußtsein, weil
sich da einige Prinzipien gut verdeutlichen lassen, die auch in
den erweiterten Bereichen Bedeutung besitzen: Ich muß überhaupt erst einmal lernen, den eigenen Körper angemessen wahrzunehmen . Mein Körper hat zu funktionieren und ich bemerke ihn meistens überhaupt erst, wenn es damit mal nicht so recht klappt, wenn irgendwo was zwickt oder gar aussetzt. Die "normale Funktion" nehme ich gar nicht mehr wahr. Hier bemühe ich mich, umzulernen. Auch wenn ich jetzt am Computer sitze, horche ich einfach mal in mich rein (bevor es wehtut!). Auf dem Kniehocker wird der Unterrücken schön gerade gehalten - aber mein krampfhaftes Nachdenken, was ich jetzt wie formuliere, bringt eine Spannung in den Oberrücken. Der drückt sich angespannt durch... Früher hätte ich das nie gemerkt. In der Yoga-Übungsstunde hält uns der Übungsleiter immer wieder mal dazu an, nachzuspüren, was im Körper vor sich geht - während und vor allem auch nach einer Übung in der Ruhelage. Jetzt muß ich das selber tun - nicht nur, wenn ich ausnahmsweise tatsächlich einmal zu Hause ein paar Übungen wiederhole - sondern eben auch im Alltag. Was mache ich nun mit meinem gespannten Rücken? Ich kann den Muskeln den Befehl geben, sich zu entspannen... Hm, das klappt irgendwie nicht. Befehle sind immer etwas Spannendes, niemals etwas Beruhigendes.
Mir hilft im Moment, bewußt gleichmäßig durchzuatmen.
Den Atem hatte ich nämlich auch etwas meinem Denkprozeß
angepaßt und gespannt angehalten, dann befriedigt wieder
ausgepustet - aber eben ungleichmäßig, stockend. Jetzt
lasse ich ihn los, lasse ihn fließen, wie er will. Dabei
weitet sich der ganze Körper - und auch der Rücken bekommt
etwas ab von dieser Weitung, dieser Kräftigung. Nach einer
Weile spüre ich, daß ich keine Kraft mehr aufwenden
muß, ihn gerade zu halten. Der Atem hält ihn aufrecht,
die Muskeln entspannen einfach - ich brauche sie nur loszulassen.
Rein physiologisch hält natürlich nicht die physikalische
Kraft der Atemluft meinen Rücken aufrecht. Aber der kräftige
Atem belebt alle inneren Vorgänge im Körper, die letztlich
zu einer solchen Stabilisierung führen. Wir haben im Körper
Vorgänge, die wir direkt steuern können, und solche,
die automatisch ablaufen. Der Atem ist wie ein Scharnier zwischen
diesen Vorgängen. Er läuft zwar automatisch ab - kann
aber von uns bewußt geregelt werden. Durch diese Regelung
nimmt er Einfluß auf die normalerweise nicht bewußt
beeinflußbaren Faktoren wie Blutbewegung, Herzschlag, Lymphbewegung
usw.
Die Entspannung meines Rückens verweist auch auf das notwendige
Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung. Yoga wird oft als
"Entspannungsübung" verkauft. Eigentlich heißt
Yoga "Anspannung". In den Übungen werden auch meistens
gezielt einige Regionen des Körpers angespannt und in dieser
Anspannung gehalten. Es zwiebelt dann meistens irgendwo (das sind
die Muskeln die gedehnt oder gekräftigt werden) - aber erstens
hilft die Kraft des gleichmäßigen Weiteratmens auch
diesen Muskeln noch etwas länger durchzuhalten und zweitens
ist es wichtig, die nicht gebrauchten Regionen des Körpers
auch tatsächlich in Ruhe zu lassen. Nicht den ganzen Körper
verkrampfen! (Am Gesicht sieht man das sicher am deutlichsten,
ob man was verkrampft, was eigentlich der wirklichen Bewegung
ganz und gar nicht helfen kann).
Ein guter Übungsleiter wird dann auch genau wissen, welche
Regionen in welcher Reihenfolge und Abwechslung wie arbeiten sollen
- und wie die Ruhelage dazwischen ganz bewußt genutzt wird,
den eigenen Körper und seine innere Ruhe und Arbeit im Wechsel
von Entspannung und Spannung wahrzunehmen. Der berühmte Lotussitz
(Beweglichkeit) ist also viel unwichtiger für Yoga als das
Lernen der inneren Wahrnehmung.
Wahrnehmung ist nun schon nichts rein Körperliches mehr,
sondern berührt das Bewußtsein. Viele moderne Psychotechniken
haben in diesem Jahrhundert wieder neu gelernt, daß das
Psychische und das Körperliche eng verbunden sind. Daß
der Körper über die Psyche beeinflußbar ist (autogenes
Training) und daß der Körper psychische Inhalte trägt,
ausdrückt, in sich aufbewahrt (Verspannungen, bis hin zu
dem erwähnten Bluthochdruck...). Sportliche Höchstleistungen
sind auch nur noch mit einer gezielten mentalen Vorbereitung und
Aktivierung möglich. Wichtiger jedoch als das Vollbringen körperlicher Höchstleistungen für Einzelne ist die Möglichkeit des bewußten Umgangs mit sich Selbst für alle. Die Psychoanalyse versucht ein besseres Kennenlernen von sich selbst durch das Ins-Bewußtsein-Bringen des Un-Bewußten, Verdrängten. Andere Techniken und Therapien greifen auch schon auf das Wissen des Körpers über geistige Verspannungen zurück.
Yoga ermöglicht noch etwas: die geschulte Wahrnehmungsfähigkeit
ist nicht nur auf Vergangenes, Un- und Unterbewußtes gerichtet,
sondern gestattet auch die Wahrnehmung von Noch-nicht-Bewußtem
in sich Selbst. Verborgene Bedürfnisse können gefunden
werden, die man sich bewußt vielleicht gar nicht gestattet
hätte (nach Ruhe und Entspannung z.B., also "Faulheit"...
oder einem Räkeln, einer gezielten Anspannung von Körperregionen,
die Luft und Kraft brauchen und dann dahin schicken, wo sie aktiv
werden können...).
Für mich ergeben sich aus dem, was ich bisher aus Yoga gelernt
haben, zwei wichtige Regeln für den Alltag: ich achte erstens
auf eine gerade Wirbelsäule und zweitens auf einen ruhigen,
gleichmäßigen Atemfluß.
Schon in diesem eher körperlichen Bereich stoßen wir
auf einen Zusammenhang, der uns immer wieder begegnen wird: In
uns leben die Moleküle und Zellen und Organe ihr und unser
Leben. "Es" wirkt einfach in uns. Unser
Handeln beeinflußt es: hemmend oder befördernd und
auch lenkend. Lassen wir das alles im Unbewußten dahinfließen
oder auch stocken und rütteln, leben wir in Bezug auf uns
Selbst unbewußt wie die Tiere. Menschen jedoch haben größere
Möglichkeiten. Ihre Bewußtheit kann sich auch auf die
tieferen Lebensschichten erstrecken. Das Handeln kann bewußt
in das bewußtlose Wirken eingewebt werden. Dabei sollte
das bewußte Handeln nicht alles Wirken beherrschen wollen,
sondern auch das bewußte Wirkenlassen des Unbewußten
(Atem fließen lassen) gehört dazu. Wirken(lassen)
und Handeln gemeinsam ergibt unser Selbst, unser sich bewegendes
und veränderndes Selbst.
Ich möchte das aber jetzt einmal nicht in Hinsicht auf den
Körper erörtern, sondern in Bezug auf das Bewußtsein
und das Denken.
Denken und Wesen Seit einigen Jahrhunderten sind wir Menschen stolz darauf, die Fähigkeiten des Geistes enorm weiterentwickelt zu haben. Wir denken und denken und bauen Denksysteme riesigen Ausmaßes mit komplizierten Vernetzungen auf. Öfters mal stürzen sie dann wieder zusammen und es werden neue konstruiert. Ab und an sagt dann mal einer: Wir müßten uns mal selber zusehen, wie wir immer wieder bauen und bauen und bauen... Das Nachdenken übers Nachdenken, die "Reflexion der Reflexion" wird dann auch das Markenzeichen der klassischen deutschen Philosophie (und deshalb ist sie so besonders kompliziert zu verstehen).
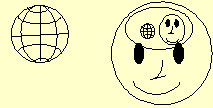 Schon für das einfache Wahrnehmen ist es wichtig, darüber nachzudenken, was wir eigentlich wie und wann wahrnehmen. Optische Täuschungen sind das einfachste Beispiel dafür, daß schon unsere Sinne nicht einfach wie ein Spiegel alles widergeben. Das "Beobachten" des "Beobachtens"(=Wahrnehmens) ist für die Biologie vor einigen Jahrzehnten entdeckt worden und auch auf das menschliche Wahrnehmen und Denken angewandt worden. Z.B. ergibt sich daraus der Hinweis, daß nur das wahrgenommen oder geistig aufgenommen wird, worauf die Sinnensorgane oder der Geist schon eingestimmt sind. Was wir nicht sehen/wahrnehmen wollen, sehen wir auch nicht! Dadurch ist das Dazulernen, das Standpunktwechseln, das Verstehen von anderen Standpunkten auch so schwer - aber für die bewußt denkenden Menschen auch nicht unmöglich.
Wesentlich dafür ist, den eigenen Denk-Weg auch mal kritisch
in Frage stellen zu können. Wenn ich mit allem (fremden oder
eigenen Denken) zufrieden bin, werde ich niemals einen Schritt
weitergehen, weiterdenken.
Die Kritik ist aber schwer, wenn man immer nur gelernt hat, aufzubauen
und sein Kunstwerk zu schützen. Dann kommt man schnell in
eine dogmatische Verteidigungshaltung und riskiert keine neuen
Ideen mehr... Die indische Tradition geht einen anderen Weg.
Hier wird nicht (nur) konstruiert und aufgebaut, sondern es wird
losgelassen. Die Hoffnung besteht darin, daß das Wesentliche,
Wichtige dann erhalten bleibt, daß aber das bewußte
Loslassen alles fortspült, was unnötig ist (wie die
unnötigen Spannungen im Körper). Der bewußte Umgang mit dem Körper ist hilfreich für dieses Loslassen im geistigen Bereich. Die Ruhigstellung der Muskulatur senkt die motorische Nerventätigkeit. Die innere Alarmhaltung nimmt ab, die innere Konzentration steigt. Werden die (im allgemeinen immer "mitdenkenden") Gesichtsmuskeln entspannt, sinkt auch die geistige Aktivität. Eine Entspannung der Augenmuskeln bringt die bis dahin vorherrschenden optischen Vorstellungen zum Verschwinden.
Dadurch wird auf nichtdenkendem Wege eine kritische Distanz zum
Denken erreicht (In der europäischen Geistesgeschichte versucht
man die Kritik auch immer nur rein denkerisch zu konstruieren!).
Ich muß gestehen, daß ich so weit noch nicht im Üben bin. Aber ich tröste mich damit, daß man ja gerade nicht verkrampfen soll - auch nicht bei dem Gedanken daran, was man vielleicht noch lernen, noch tun sollte...
Deshalb gehe ich jetzt einen anderen Weg und leiste mir ein "faules
Stündchen" auf dem Sofa bei guter Musik...
... Jetzt bin ich wieder da. Bei diesen Ruhezeiten hatte ich übrigens
früher wirklich ein schlechtes Gewissen wegen meiner "Faulheit".
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß das Kreisenlassen
der Gedanken beim Ausruhen oft die besten Gedankenketten und Ideen
hervorbringt. Wenn ich mal längere Zeit ohne diese Gelegenheiten
arbeiten mußte, ist meist auch nicht viel herausgekommen...
Ohne jetzt noch mehr Theorie auszubreiten, können wir uns
aber noch mal an das Verhältnis von Wirkenlassen und Handeln
erinnern. Auch bei den Denkprozessen in uns (als denkendes
Wirken) und dem bewußten (meist logischen) Denk-Handeln
gibt es ein aufeinanderzuarbeiten dieser unterschiedlichen Aspekte.
Ich habe bisher wenig zu dem geschichtlichen Hintergrund und den
Inhalten der verschiedenen indischen Weisheitslehren gesagt. Das
würde auch den Rahmen dessen, was ich mir vorgenommen habe,
sprengen. Aber einige Bezüge zu unseren aktuellen Fragen kann man verdeutlichen:
In Indien ging die Entwicklung nicht so stürmisch voran wie
in Europa. Die unterschiedlichen Interessen verschiedener Menschengruppen
wurden nicht so drastisch auf die Spitze getrieben, sondern konnten
sich nebeneinander ausleben. Deshalb gibt es auch nicht "die
eine wahre" Religion, sondern mannigfaltige Religionsformen
in vielen kleineren oder größeren Gruppen, die miteinander
recht tolerant umgingen und auch viel voneinander entnahmen und
lernten statt sich zu bekämpfen. Deshalb vermischen sich
auch in den Textquellen so viele Inhalte und lassen sich nicht
eindeutig zuordnen. Auch die Interpretation läßt dadurch
viele Spielräume (auch für meine ganz persönliche
Deutung...).
Dazu kommt, daß Indien nicht nur im Geistigen, sondern auch
im realen Leben mannigfaltige Nischen ließ, in denen verschiedene
Lebensweisen blühen konnten. Der "Asket im Wald"
konnte im warmen und fruchtbaren Klima durchaus im Wald leben
- was in den europäischen, kalten Gebieten nicht möglich
wäre (deshalb ist in deutschen Märchen der Wald etwas
Kaltes, Dunkles, Unheimliches - während in indischen Mythen
der Wald etwas Heimatliches, Fruchtbares, Mütterliches verkörpert).
In der Zeit der Entstehung der Grundgedanken, die Yoga zugrundeliegen,
stand Indien gerade vor neuen Entwicklungsmöglichkeiten.
Es entstanden Städte, der Handel und das Handwerk blühten,
neue Erwerbsmöglichkeiten und damit Lebensformen entstanden.
Dadurch kam es zu einer Auflösung früherer Lebenszwänge,
aber auch dem Verlust früherer Sicherheiten (in der zwar
patriarchalen, auch in Kasten geteilten, aber doch Gemeinschaft).
Sollte man sich vorbehaltslos dem Neuen verschreiben (Geld machen...),
oder doch lieber beim Früheren beharren? Alle Möglichkeiten wurden in irgendwelchen Lebensformen und Denksystemen ausprobiert. Die früher im geistig-religiösen Bereich vorherrschenden Brahmanen, die ihre Macht vorwiegend aus der Kenntnis der vielfältigen Opferrituale schöpften, übernahmen viele der neuen Ansätze. Einerseits gab es Modelle, die die neuen Aktivitäten rechtfertigten und den Menschen halfen, sich der ungewohnten Dynamik zu stellen. Dies benötigten vorwiegend die Krieger und Händler. Andere Modelle wiederum entsagten jeglicher Aktivität und suchten das Heil in der totalen Loslösung von den Tätigkeiten. Beide zielten nicht vorrangig auf etwas Jenseitiges, wie es das Christentum in Europa tat. Die indischen Weltanschauungen suchten das Heil im Diesseitigen, im richtigen konkreten weltlichen Handeln. Während in Europa das Mystische, Kontemplative (Versenkende) in Richtung des Jenseitigen kanalisiert wurde, bekam das Weltliche eine Dynamik, die jetzt kaum jemand mehr in Frage stellt. Diese Dynamik stellt das Technische, die Arbeit in den Vordergrund, diskutiert nicht mehr über das Ziel der Entwicklung und verwechselt dabei Mittel und Zweck. Die Mittel Technik und Arbeit zum Zweck der Lebenserfüllung und Bedürfnisbefriedigung werden zum Zweck an sich, der nicht mehr an anderen Zielen gemessen werden darf. Inzwischen zerstören diese falschen Zwecke sogar ihre eigenen Grundlagen (ökologische und soziale Probleme). In Indien setzte sich eher eine Tradition durch, die zwischen den beiden eben genannten Modellarten Aktivismus und Passivität zu vermitteln sucht. Die Bhagavadgita ist ein Lehrgespräch zwischen dem am Kampf zweifelnden Krieger Arjuna (Ardschuna gesprochen) und Krischna, der das Problem erläutert. Krischna will Arjuna zum Kampf überreden (was natürlich aus unserer Sicht fragwürdig ist!), aber er spricht dabei die grundlegende Frage nach dem Verhältnis von Aktivität und Passivität an. Tendenziell fordert er eine Lebensweise, in der man zwar tut, was zu tun ist - ohne sich allzusehr auf das Ergebnis festzulegen. Nicht an den Dingen, an den Begierden hängen, sich nicht von ihnen abhängig machen - aber auch nicht nur rumsitzen, sondern durchaus das tun, was getan werden muß. Was getan werden muß, sagt der Krischna dem Arjuna: nämlich in diesem Fall auf dem Schlachtfeld kämpfen.
Wir gehen weiter und sagen: auch das liegt in unserer Entscheidung.
Auch Yoga (als Lebenspraxis) und die ihr entsprechende Denkweise
gehen den mittleren Weg. Einerseits gilt es, aus überlieferten
Ordnungen auszubrechen - aber nicht so leidenschaftlich zu werden,
daß man "verbiestert" (wie es manche politische
Akteure dann sind). Andererseits soll man sich aber auch nicht
hängen lassen, notwendige Dinge nicht tun. Richtig ist eine
harmonische ausgeglichene Lebensweise, die es in der Welt trotz
aller Widersprüche aushält und ihr Handeln in das Wirken
einwebt.
Die Ausgangsfrage "Sollte ich mich den Umständen anpassen
oder Umstände suchen, so ich hingehöre?" kann nun
erweitert werden:
Ich kann ja die Umstände mit verändern! Und ich verändere
mich dabei selbst auch wieder mit.
Das Verhältnis von Mir und der Welt wird in verschiedenen
Modellen auch unterschiedlich gesehen. Auf der einen Seite wird
betont, daß ich Eins mit mir selbst bin - aber immer in
einem Widerspruch zur Welt stehen werde. Mein innerstes Wesen
und meine Existenzweise können nie absolut übereinstimmen
- es wird da immer eine Lücke geben. Auf der anderen Seite
wird gesehen, daß ich trotzdem in dieser Welt lebe und auch
mit ihr Eins bin. In diesem Sinne ist der berühmte Satz zu
verstehen : "Tat tvam asi" ("Das alles, um dich
herum, bist du").
Bei Krischna ist jeder Mensch zwar etwas Eigenes, nur mit sich
selbst Identisches, aber diese Identität gewinnt er nur
beim Einbringen seines Handeln in das universelle Wirken (der
Umstände).
Wer dieser Identität in ihrer ganzen Bewegtheit und Veränderlichkeit
dann auch noch bewußt ist, wird nicht mehr verzweifeln an
den Lücken zwischen seinem tiefsten Wesen, und dem, was zur
Zeit real existieren kann. Seine Einheit ist in sich gefestigt,
nicht so leicht zu erschüttern und kann deshalb auch Konflikte
ohne Angst um sich selbst innerlich ruhig bestehen. Sie ist aber
auch beweglich, offen gegenüber neuen Möglichkeiten
der eigenen Entwicklung. Im indischen Denken gibt es die Vorstellung, daß jeder diese Lebensweise und -haltung in Perfektion erlernen könne. Wer nun schon wieder Angst hat, das eh nicht zu schaffen (oder es weiß, wie ich), könnte sich nun abgeschreckt fühlen.
Aber die Grundidee war ja: nicht einem Ziel total verbiestert
nachlaufen zu müssen. Ich kann einfach einiges in meinem
Leben versuchen, einiges hinnehmen, einiges zu verbessern suchen
und immer weiterlernen. Nicht das Ziel ist das allein Wichtige,
sondern auf dem Weg dahin muß ich mich besser fühlen
und dann werde ich auch mehr erreichen. Wenn das eine nicht wird,
dann versuche ich was anderes. Manchmal entsteht daraus etwas
Besseres, als ich geplant hatte. Andererseits - ohne überhaupt
was zu tun, würde natürlich auch nichts. Also mach ich
erstmal weiter mit meinen wöchentlichen Kursstunden, mach
aus den nächsten Texten das eine (Weitergeben) oder das andere
(Internet), vielleicht entsteht daraus auch das eine (Diskussionsrunden
) oder andere oder auch nichts...
siehe auch:
|