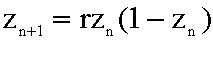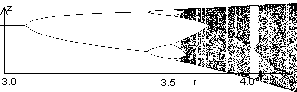|
Selbst-Organisation |
 |
|
Seit vielen Jahrzehnten wird erfolgreich Kybernetik als "Steuerungslehre" zur Strukturierung, Planung und Realisierung von Produktionsprozessen verwendet. Sie geht jedoch von einem recht statischen Soll-Zustand aus, der im Idealfall erhalten bleibt. Hierbei wird ein Prozeß vorausgesetzt, der optimal gestaltet, am besten völlig ohne Störungen und Veränderungen ablaufen soll. Im Laufe der Jahre verändern sich Anforderungen und Möglichkeiten, der gesamte Prozeß wird neu gestaltet... und soll dann wieder möglichst störungsfrei ablaufen. Im Prinzip werden in diesen Strukturen kurzzeitige Ungleichgewichte immer wieder "ins Gleichgewicht gebracht". Dies ist aber heutzutage eine veraltete Vorstellung und Praxis. Die heutige wirtschaftliche Dynamik (ihr Gesamtziel sei hier nicht diskutiert) besteht eigentlich nur aus Störungen und Ungleichgewichten. Es ist nicht mehr möglich, dem alten kybernetischen Prinzip entsprechend aller paar Monate neu zu optimieren und dann auf Störungsfreiheit zu hoffen. Der Umstellungsaufwand wird viel zu hoch. Dies liegt daran, daß sich im Laufe der Entwicklung der Produktionssysteme ihre Komplexität stark erhöht hat und nur noch komplexe und flexible Unternehmen eine Überlebenschance auf dem Weltmarkt haben.
Es ist üblich, vorwiegend den zweiten Aspekt als "Selbst-Organisation" zu bezeichnen. Das entstandene System erhält sich autopoietisch aufrecht, so daß Sein und Werden nicht voneinander zu trennen sind. |
|
Selbst-Organisation |
||
|
Kennzeichnung der möglichen Ordnungszustände bei Systemen mit miteinander verknüpften Komponenten |
Prozeß der Aufrechterhaltung komplexer Strukturen |
Spontane Bildung komplexer Strukturen/Prozesse bei bestimmten Voraussetzungen - |
|
d.h. diese Ordnungszustände entsprechen stationären Nichtgleichgewichtszuständen mit hohem Ordnungsgrad |
durch Selbsterzeugung der Randbedingung |
- auch bei einfachen Strukturen/Prozessen möglich (z.B. physikalisch) |
|
d.h. erfaßt nicht die qualitativen Umbrüche und die Rolle des "Schmetterlingseffekts" |
d.h. auch: |
|
|
"Selbst-Organisation" kennzeichnet die spontane Strukturbildung durch komplexe Systeme unter bestimmten Voraussetzungen auf Grundlage einer nichtlinearen Dynamik.Selbstorganisation ist ein "irreversibler Prozeß, der durch das kooperative Wirken von Teilsystemen zu komplexen Strukturen des Gesamtsystems führt" (Ebeling, Feistel, 1986).Dieser Prozeß erfordert das Vorhandensein eines Nichtgleichgewichts, das (thermodynamisch) durch Energiezufuhr und Entropieexport aufrechterhalten werden kann, das Vorhandensein von Fluktuationen (aus deren Verstärkung die Struktur entsteht) und nichtlineare Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Elementen. Während das System (thermodynamisch: gegenüber Energie- und Entropiebewegung) offen sein muß, verhält es sich weitgehend autonom. Wenn die Ungleichgewichtsbedingungen (Randbedingungen) nicht primär von außen vorgegebenen sondern selbstaufrechterhalten werden, spricht man auch von einem autopoietischen System.
Die Voraussetzungen für Selbstorganisation (Nichtgleichgewicht, Nichtlinearität) können beispielsweise modelliert werden in einer Formel: |
|
|
d.h.: das Ergebnis zn wird wieder in die nächste Rechnung eingesetzt... |
|
Für die logistische Gleichung (s.o.) wird i.a. auch das Bifurkationsbild (in Abhängigkeit vom Parameter r) abgebildet. |
|
|
Der wachsende Parameter r entspricht wachsendem Ungleichgewicht. Es zeigt sich, daß die Anzahl der möglichen Systemzustände an gewissen "Bifurkationspunkten" sich vervielfacht. Erstens verändert sich der vorherige Zustand auf jeden Fall und zweitens stehen i.a. mehrere neue mögliche Zustände zur Auswahl. Hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten:
Diese typischen Evolutionsmuster sind durch die Biologie bestätigt worden. Im wirtschaftlichen Bereich begegnen uns ebenfalls alle drei Muster:
Im Ergebnis entstehen komplexe Strukturen, deren Stabilität davon abhängt, daß sie die Entstehungsbedingungen aufrechterhalten. Das bezieht sich vor allem auf die Offenheit und die Entfernung vom jeweiligen Gleichgewicht. Sich selbst organisierende, komplexe Strukturen können nur durch ständige Prozessualität aufrechterhalten werden. Warum ist das Wissen darüber für das gezielte Handeln wichtig? (vgl. Strauß)
Die wichtigste Voraussetzung für Selbstorganisation ist das Vorliegen eines Ungleichgewichts. Bisherige Überlegungen gehen aber immer davon aus, einen kontinuierlichen Produktionsprozeß planen und realisieren zu wollen und "Störungen" zu eliminieren ("Natürlich ist der störungsfreie Ablauf das Ziel." (Frei, Hugentobler u.a., S. 150)). Dies entspräche aber dem Streben hin zu einem idealen Zustand, dem Gleichgewicht. Die neuartige Sicht auf dynamische Systeme verlangt jedoch nicht das Ausschalten von Störungen, sondern das "Surfen" auf ihnen. Wie beim Buttern werden Erschütterungen gebraucht. Die Veränderungen sind das Herz der Prozesse, Produktions- und Planungsumstellungen sind keine aufwendigen, zu verhindernden Blockaden mehr, sondern tragen den gesamten Prozeß (® (Change Management) Selbst-Organisation betont gegenüber den früheren kybernetischen Steuerungsstrategien, daß die Wesensmerkmale des Systems von ihm selbst erzeugt werden. Das bedeutet keine Unabhängigkeit von der Umgebung. Im Gegenteil: durch die Umgebung müssen die Bedingungen gesichert werden, die Selbstorganisation im System erst ermöglichen (Ungleichgewicht, optimal: Ko-Evolution). Während von Selbst-Organisation auch dann gesprochen wird, wenn die Randbedingungen von außen erzeugt werden, zeichnet sich der autopoietische Prozeß dadurch aus, daß auch die Randbedingungen im System selbst erzeugt werden. Dies wäre für ein autonomes Unternehmen deshalb die optimale Systemdynamik. Es ist dabei nicht ausreichend, z.B. durch Nutzung einer externen Unternehmensberatung die Firma auf die aktuellen Umfelderfordernisse einzustimmen, ohne gleichzeitig jene Prozesse zu implementieren, die ein weiteres "Mitsurfen" in der Veränderung ermöglicht. Es geht nicht mehr nur darum ein SOLL dem IST gegenüberzustellen und zu erreichen, sondern Prozesse zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, die ständig von selbst neue Soll-Zustände generieren! |
|
Eigenschaft |
Schlußfolgerung |
|
Neues entsteht
|
Kreativität braucht: Bedingungen für Kreativität UND Verstärkung der Ergebnisse;
Anknüpfen an systeminternen Differenzen (Boos) |
|
Möglichkeitsfelder in verschiedenen Horizonten (systemimmanent - überschreitend) |
Variabilität, Verschiedenheit als Quelle von Veränderungen ("Diversity Management", (Goorhuis)), Fehlerfreundlichkeit, Reserven, Diversifikation, Komplexität sinnvoll steigern |
|
"Sprung" in neue Zustände ("Paradigmenwechsel") |
Neuen Prinzipien eine Chance geben, alte Logiken nicht "hinüberzerren", Zielbestimmungen hinterfragen |
|
Zusammenhang von Bestimmtheit und Offenheit |
Planungshorizonte verflechten, Bedingungsanalyse, "Umkippen" prognostizieren, Variantenwahl beeinflussen |
|
Negation der Negation |
Zielvariabilität, Funktionswechsel |
|
"nichtspezialisierte Abstammung" |
Überspezialisierung vermeiden |
|
Wesentliche Schritte in kleinen Populationen |
Kreative Nischen organisieren |
|
In der Wirtschaft herrschen Konkurrenzbedingungen, die dazu führen, daß nicht alle Organisationen (sich selbst organisierend) überleben. Die dabei nicht erfolgreichen werden aus dem Blick verloren. Hier zeigt sich, daß die Gesamtgesellschaft auf diese Weise eben keine Gleichberechtigungs-Netzwerk-Gesellschaft neuen Typs ist, sondern die Netzwerke lediglich der Machtverstärkung der Mächtigsten dienen. |
|
Literatur (mit externem Boos, F., Zum Machen des Unmachbaren - Unternehmensberatung aus systemischer Sicht, in: Balck, H., Kreibich, R., (Hrsg.), Evolutionäre Wege in die Zukunft. Wie lassen sich komplexe Systeme managen?, Weinheim-Basel, 1991 Ebeling, W., Feistel, R.: Physik der Selbstorganisation und Evolution, Berlin 1986 Eigen, M., Winkler, R., Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall, München, Zürich 1990 Goorhuis, H., Management 2. Ordnung, in Internet: http://www.weiterbildung.unizh.ch/texte/Mgt2Org.shtml (1998) Haken, H.; Synergetik, 1983 Prigogine, Vom Sein zum Werden. Zeit und Komplexität in den Naturwissenschaften, München, Zürich 1988 Schlemm, A., Daß nichts bleibt, wie es ist... Münster 1996 (Bd. 1) und 1999 (Bd 2) Strauß, R., Komplexität und Regionalisierung, Vortrag auf Internationalen Symposium "Die Region im Spannungsfeld von Tradition und Moderne" in Merseburg 08,.09.Oktober 1999 (Manuskript, im Druck) |
| Komplexität Selbstorganisations-Management Selbst-Organisation Homepage der Autorin |
© Annette Schlemm 1999