|
1.3. Das Wahrheitsproblem
Aus den typischen Unterschieden, die die verschiedenen Strukturniveaus
konstituieren, ergibt sich auch, daß es sinnvoll ist, die
Beschreibung von Eigenschaften auf die jeweilige Stufe zu beschränken.
Die Gesetzmäßigkeiten, auf deren Erkenntnis
Wissenschaft zielt, beziehen sich ebenfalls jeweils auf bestimmte
Niveauebenen. (Entwicklungsprozesse umfassen
Wechselbeziehungen zwischen bestimmten, angebbaren Stufen und
müssen konkreter erfaßt werden).
Es ist deshalb möglich, auf einem bestimmten Strukturniveau
zu einer relativ wahren Erkenntnis der Beziehungen innerhalb
dieses Niveaus und zu den anliegenden Niveaus zu gelangen. Der
umfassende statistische Gesetzesbegriff
(HÖRZ) erfaßt auch nicht reduzierbare Unbestimmtheiten,
besonders bei Prozessen von nichtvorhersagbaren Qualitätsänderungen.
Dieser von LENIN herrührende Begriff der relativen Wahrheit grenzt sich ab von Erwartungen einer absolut vollständigen Erkenntnis aller Wechselwirkungen und Zusammenhänge, die allein schon wegen der Unerschöpflichkeit der Beziehungen unmöglich ist.
Jedoch ist er wichtig, um zu verankern, daß Erkenntnis
relativ wahre Erkenntnisergebnisse ermöglicht, wenn man jeweils
die Bedingungen der Erkenntnis als Teil der Aussage ansieht.
Diese Unterscheidung trifft die EE nicht. Sie verabsolutiert die
Relativierung der Wahrheit jeglicher Erkenntnis, und konstatiert
lediglich: "Es gibt kein sicheres Wissen."
Problematisch wird dies dann, wenn diese These die Grundlage für
einen konstruierten Widerspruch zwischen biotischem "Erkennen"
und dem Erkenntnishorizont des Menschen wird (R.RIEDL in 6,94ff.).
Dieser Widerspruch entfällt sofort, wenn man die Gebundenheit
der Erkenntnis (und damit ihre natürliche Unterschiedlichkeit)
an die einzelnen Strukturniveaus betrachtet. Abgesehen von den "Ausrutschern", an denen die EE ihrer eigenen Logik nicht mehr folgt (keine Anerkennung einer relativen Wahr heit für mögliche Erkenntnis, vollzogener Reduktionismus entgegen weltanschaulicher Ablehnung),führt die Anerkennung von diskontinuierlichen Unterschieden zwischen den Ebenen zu der Frage, wie diese überbrückt werden. Die Antwort bei K.LORENZ lautet, daß sie überbrückt werden durch einen "Funken", einen "Blitz". Diesen Prozeß nennt er Fulguration. Nun ist das Einführen eines Begriffs für etwas Unverstandenes noch keine Beantwortung einer Frage. Er erklärt es aber auch genauer (1,50f.):
Das Neue ensteht meist durch Integration von bis dahin unabhängigen
Systemen zu einer höheren Einheit. Dabei kommt es zu Veränderungen
in ihnen, die sie zur Mitarbeit im System geeigneter machen (Goethe:
Differenzierung und Subordination). Die Teile werden dabei immer
verschiedener, so daß die Einheit des aus ihnen entstandenen
Systems auf der Unterschiedlichkeit der Teile erwächst (Unity
out of diversity - W.H.THORPE nach 1,51). Unklare Aussagen macht K.LORENZ nun dazu, ob aus den Einzelteilen auf das Gesamtsystem zu schließen sei. Seine Aussagen dazu klingen recht aus der hohlen Hand geschöpft, je nach Bedarf. Natürlich legt er Wert darauf, daß die Fulguration ohne höhere Kräfte auskommt, daß keine geistigen Wesenheiten das Ganze steuern. Deshalb legt er auf eine Bedingtheit des Ganzen durch die Teile und nichts anderes (Übernatürliches) Wert (vgl. 1,53).
Damit hat er Recht. Wenn er aber dann ausrutscht und meint, das
Neue Ganze sei aus der nächst-niedrigen Stufe heraus vollständig
erklärbar, begibt er sich in die Nähe zu den Reduktionisten,
denen das Ganze eben nicht mehr als die Summe der Teile ist. Dies
lehnt er aber an anderen Stellen mehrmals explizit ab: "Die
Fulguration trägt Charakter einer Erfindung." (1,55)
Zu betonen ist die Nähe des Begriffsinhalts der Fulguration
mit dem Symmetriebruch, der aus der stheorie bekannt ist.
In dieser würden die Anhänger der EE auch weitere schöne
(und tiefergehendere, weil aus verschiedenen Wissenschaften verallgemeinerte)
Ausarbeitungen derselben Prozesse finden, die sie auch bewegen.
Leider zeigen sie sich an dieser Stelle sehr abstinent und tun
weiterhin so, als gäbe es außer der EE nichts, was
neu und wichtig ist in der Welt der Wissenschaft.
Eine vergleichende Darstellung von EE und DHM ergibt auch hier
wieder viele Parallelen. Es ist ein starkes Argument für
den Materialismus, sich die Erkenntnisfähigkeit der Tiere
und Menschen als Entwicklungsprodukt der Materie vorstellen zu
können.
Jede mir bekannte dialektisch-materialistische Erkenntnistheorie-Darstellung
verweist auch auf diese Tatsache. K.LORENZ hätte sich hier
nicht auf I.KANT beschränken müssen bei der Suche seiner
philosophischen Ahnen, denn schon bei ENGELS und MARX finden sich
entsprechende Passagen. Aber die müssen ihm ja nicht bekannt
gewesen sein- heutzutage erfordert die wissenschaftliche Ehrlichkeit
jedoch diese Ergänzung, auch wenn der politische Wind gerade
in die Gegenrichtung des Verschweigens bestimmter Denktraditionen
weht.
Um sinnvoll mit den Beiträgen der EE umgehen zu können,
ist eine vergleichende Betrachtung der Begriffsbildungen unbedingt
notwendig.
2.1. Wechselwirkung
und Widerspiegelung Der DHM trifft mit der Unterscheidung von Wechselwirkung und Widerspiegelung eine Voraussetzung, um Prozesse mit Qualitätsänderungen und Prozesse ohne wesentliche Qualitätsveränderungen voneinander unterscheiden zu können . Diese Unterscheidung macht es möglich, die auf materieller Wechselwirkung beruhenden Entwicklungsvorgänge (bei denen auch Qualitätssprünge auftreten) mit einem speziellen Instrumentarium zu beschreiben und in Unterscheidung dessen auch die Widerspiegelung als eine spezielle Form von Wechselwirkung, bei der es eben zu keinem Qualitätssprung kommt und die durch eine spezielle Subjekt-Objekt- Dialektik bestimmt ist
Der Begriff der Wechselwirkung ist dabei allgemeiner
als der der Widerspiegelung. Das zeigt sich z.B. darin, daß
sich zwar die Widerspiegelungsfähigkeit entwickelt, daß
aber die Evolution selbst nicht nur durch die Evolution
der Widerspiegelungsfähigkeit gekennzeichnet ist, sondern
andere Wechselwirkungsprozesse einschließt (beim Menschen
z.B. der materielle Stoffwechsel mit der Natur). Die EE dagegen unterscheidet nicht, sondern für sie ist Evolution identisch mit Anpassung und diese ist identisch mit Informationsaufnahme, was wiederum identisch ist mit Erkenntnisgewinn. Ausgehend von dieser Prämisse sind die entsprechenden Begriffe definiert. Information ist eben so allgemein definiert, daß in ihm alle Wechselwirkungsprozesse subsummiert sein sollen (7,270). "Auf der elementaren Ebene der Selbstorganisation kann m.H. des Informations-begriffes "Leben" und "Erkennen" gleichgesetzt werden. In beiden Fällen handelt es sich um einen informationsgewinnenden Prozeß, der nach strukturell grundsätzlich gleichen Regeln oder Gesetzen auf verschiedenen Ebenen abläuft.
Gleichzeitig lassen sich aber auch durch genauere Spezifizierung
des Informationsgewinns diese Ebenen auseinanderhalten. (OESER)"
In diesem Fall übernimmt die EE bewußt einen unwissenschaftlichen
Alltagsbegriff entgegen der "üblichen" informationstheoretischen
Definition. Das kann man machen - braucht sich aber dann nicht
wundern, wenn die Aussagen auch nicht als wissenschaftlich akzeptiert
werden, denn das von OESER angemahnte "Auseinanderhalten"
habe ich nirgendwo gefunden.
Jedenfalls lassen sich alle Beispiele aus der Biologie, der Verhaltenslehre,
den Lerntheorien auf diese Weise so verwenden, daß sie die
Ausgangsthese belegen. Die Masse der aufgeführten Beispiele,
so überzeugend sie aussehen mag, beweist nur... das vorher
Vorausgesetzte: Die Einheit von Evolution und Evolution der Erkenntnisfähigkeit.
Natürlich ist es nicht einfach, im speziellen Fall der EE
die Ebenen auseinanderzuhalten. Man verknüpft ja tatsächlich
Aussagen aus der Widerspiegelungsebene (daß die Erkenntnisapparate
auf die Realität "passen") und aus der Wechselwirkungsebene
(auf der die Entwicklungsprozesse auch des Erkenntnisapparats
stattfinden).Aus der reinen Biologie ergibt sich auch lange kein
innerer Widerspruch. Erst bei der Betrachtung kultureller Prozesse
zeigt sich verhängnisvoll die systematische Ausgrenzung
anderer als erkennender Wechselbeziehungen in der EE (wie
materielle und gesellschaftliche Praxis; Produktion...). An einer Stelle müßte jedoch auch der Biologe aufmerksam werden.
Ein recht einprägsamer Begriff für die Tatsache, daß
die objektive Realität und die Entwicklung der Erkenntnisfähigkeit
des Subjekts wechselwirken, ist das pattern matching(pattern:
anordnung, Konfiguration; matching: Feststellen und Heausheben
von Unterschieden, Begriff nach CAMPBEKK). ).
Auf der Ebene der materiellen Wechselwirkungen entspricht der
Begriff des pattern matching ziemlich gut dem der Ko-Evolution.
Im Wissen um diese Differenzen läßt sich aus der EE
jedoch vieles entnehmen, was sehr sinnvoll ist.
2.2. Erkenntnis als Subjekt-
Objekt- Wechselwirkung
Konzentrieren wir uns auf die Widerspiegelung, so können wir folgende Abbildung zur Verdeutlichung verwenden:
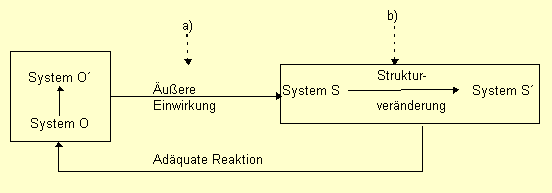
Nach LORENZ und VOLLMER bestimmt die Interaktion mit dem Milieu das Verhalten und erzeugt den Widerspiegelungsapparat. Deshalb "paßt" der Widerspiegelungsapparat auf die Realität.
"Unsere...festliegenden Anschauungsformen und Kategorien
passen aus ganz demselben Gründen auf die Außenwelt,
aus denen der Huf des Pferdes... auf den Steppenboden, die Flosse
eines Fisches... ins Wasser paßt" (LORENZ,Kants Lehre
vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie,1941).
Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß die innere Struktur des Subjekts, des Erkenntnisapparats, von außen determiniert ist. (Einfluß (a)). Dieser Erkenntnisapparat stellt nicht nur einen glatten Spiegel des Abspiegelns des Objekts im Subjekt dar, sondern verzerrt bereits die Wahrnehmung im Auge (Gestaltwahrnehmung s.u.).
Genau diese inneren Strukturen müssen berücksichtigt
werden, wenn eine Erkenntnis interpretiert werden soll.
Ausgehend von dieser Eigenständigkeit abstrahieren MATURANA
und VARELA (12) fast gänzlich von der äußeren
Determiniertheit und stellen fest, daß das Subjekt als autopoietisches
System sehr von seiner eigenen Struktur bestimmt ist (strukturdeterminiert).
Das Objekt formt deshalb im Subjekt nichts nach seinem Bilde,
sondern kann höchstens strukturdeterminierte Reaktionen auslösen
("Perturbationen"). Hier steht also die interne Determination
im Vordergrund - sicher, weil sie das direkte Forschungsobjekt
der Autoren ist.
Um diese beiden Aspekte zu verbinden, braucht man nur noch einmal
zu erinnern, daß diese autopoietische strukturdeterminierte
System durchaus über seine Evolution von außen determiniert
wurde. Aber nicht nur historisch besteht eine Verbindung vom Objektbereich
zum Subjekt, sondern auch während jeder Widerspiegelung.
2.3. Vor-Theoretische Erkenntnis Da die Widerspiegelung ein wichtiger Aspekt von biotischen Evolutions-prozessen ist (nicht der einzige, siehe S.7), lassen sich vielfältige Zusammenhänge zwischen Widerspiegelung ("Erkennen") und biotischer Evolution nachweisen. Dies leistet die EE sehr umfangreich. I.KANT hatte festgestellt, daß wir Ordnungsraster auf die eigentlich ungeordnete Objektwelt projizieren und auf diese Weise Ordnung konstituieren. Die Ordnungsraster/ Denkformen sind uns vor aller Erfahrung (a priori) gegeben.
KANT sieht diese nicht als absolut unveränderbar, sondern
durch Vernunftinteressen bestimmt. K.LORENZ betont in einem bewußten
Bezug auf KANT (er war zeitweise Inhaber des KANT-Lehrstuhls in
Königsberg), daß diese a priori- Denkformen evolutionär
entstanden sind. Sie sind deshalb zwar a priori (angeboren; vor
aller Erfahrung) für das Individuum, aber a posteriori (nach
der Erfahrung) für die Gattung, in deren Evolution sich der
Erkenntnisapparat an die (über Mutation und Selektion) erfahrene
objektive Realität an"paßt". Bereits HAECKEL erkannte: " (Die) Fähigkeit zu Erkenntnissen a priori ist aber ursprünglich entstanden durch Vererbung von Gehirn-Structuren, die... durch Anpassung an synthetische Verknüpfungen von Erfahrungen, von Erkenntnissen a posteriori erworben wurden." (nach 7,19), und für MARX stand fest: "Die Bildung der 5 Sinne ist die Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte" (MARX MEW Bd.19,S.362f.).
Die Wahrnehmungsorgane/ Erkenntnisapparate "passen"
auf die Strukturen der Umgebungsrealität. Diese
Passung entstand
im Ergebnis von Anpassungsleistungen in der biotischen Evolution.
Sie führt dazu, daß der Erkenntnisapparat kein "idealer Spiegel" zur Aufnahme der Außeninformationen ist, sondern diese Informationen bereits umformt. Das beginnt bereits bei physiologisch - selektiven Informationsaufnahme im Auge (Anordnung der Sehzellen). Auch der zur Verarbeitung ankommende Input im Gehirn ist ein Ergebnis der unbewußten Informationsverarbeitung durch das Gehirn (SEITELBERGER in 7,182). Der Input wird in der Hirnrinde modular bearbeitet ("assoziative Funktion"). Während 109 bits/sek. das Gehirn erreichen, werden nur 100 bits/sek. für die bewußte Wahrnehmung ausgewählt (7,192). Die ursprüngliche Information wird vielfältigen Vermittlungen in einem "Komplex innerer Bedingungen" (11,27) unterworfen. Im Sinnesorgan, in der Reizleitung und im Gehirn wird bereits selektiert und synthetisiert (vgl. auch 14, 156ff.). Dabei werden verschiedene Umformungen der Information wahrgenommen, die i.a. als Gestaltwahrnehmung diskutiert werden.
Zum Beispiel werden konstante Eigenschaften der Gegenstände
(Farbe, Größe, Richtung und Form) unabhängig von
den konkreten Wahrnehmungsbedingungen (Lichteinfall, Entfernung...)
als konstant wahrgenommen. diese unbewußten Verrechnungsvorgänge
werden in der Tradition der EE als ratiomorph bezeichnet.
Die systematischen "Verzerrungen" der Informationen, die das Subjekt erreichen, sind lebensnotwendig. Andererseits muß man sie kennen, wenn man die Wahrnehmungen und Denkleistungen bewußt analysieren will. R.RIEDL warnt deshalb pronounciert vor der Irreführung der menschlichen Erkenntnis durch diese unbewußten Leistungen des Erkenntnisapparats. Anderseits beruhen alle letztlich über diese unbewußten Prozesse hinausführenden und sie überwindenden bewußten Prozesse auf diesen unbewußten Vorleistungen.
Das beginnt, wie K.LORENZ zeigte bei dem Primat der räumlichen
Wahrnehmung gegenüber z.B. motorischen, das den Weg für
ein nur scheinbares,"vorgestelltes" Hantieren im Vorstellungs-"Raum"
als erster Form des Denkens freimachte. Ebenso beruht das Gedächtnis
und die kreative Vorstellungskraft auf diesen Mechanismen. Vorleistungen für das spätere menschliche Erkenntnisvermögen gibt es also bereits bei den Tieren. Sie haben die "Möglichkeit, Objekte in kognitiven Strukturen und emotional- motivationalen Wertungsstrukturen" zur repräsentieren (ERPENBECK: 15,15). Dabei können frühere Erfahrungen, die im Gedächtnis gespeichert sind, mit aktuellen verglichen werden (VOLLMER: 16,74). Ebenfalls ist bereits ein elementares Denken als "Hantieren im Vorstellungsraum" (K.LORENZ) möglich.
Das Erkennen im tierischen Bereich ist also bereits eine Relation:
A erkennt B als C. Wodurch erhebt sich das menschliche Erkennen nun auf eine höhere Stufe, die entsprechend der Wesensverschiedenheit verschiedener "Seinstufen" nicht mehr auf niedere Formen reduzierbar ist? Ein Vergleich macht das deutlich: Seine spezifische Art und Weise der Wechselwirkung mit der Umgebung, der , führt dazu, daß diese Wechselwirkung sich wesentlich von der durch Tiere vermittelten unterscheidet: a) durch die Zielbewußtheit des Stoffwechsels mit der Natur, der Produktion, b) durch den gesellschaftlich-bewußten Charakter dieser Praxis. Der Mensch hat nicht nur das Gedächtnis als einfache Repräsentation der Erfahrungsinhalte zur Verfügung, sondern kann mit der Sprache Objekte benennen und abstraktere Manipulationen ausführen ("doppelte Repräsentation").
Dies ist die Voraussetzung für das Erkennen von Gesetzmäßigkei
ten und das Überwinden der systematischen Wahrnehmungsverzerrun
gen durch den ratiomorphen Apparat.
2.4.1. Zuständigkeitsbereich
der EE Unbestritten ist die evolutionäre Bedingtheit der biotischen Vorleistungen für die menschliche Erkenntnistätigkeit.
Wie weit jedoch reicht die Kompetenz einer biologischen Erkenntnistheorie
in die Gefilde der spezifisch menschlichen Form des Erkennes,
des theoretischen Erkennens hinein? Die Aussagen von Vertretern der EE sind hier etwas widersprüchlich. Einerseits bezieht sich VOLLMER auf die unbewußte und unkritische Rekonstruktion der Wahrnehmung, die deshalb stets nur hypothetischen Charakter behalten könne (16). Da man (wer ist "man"?) nur wisse, was für die Arterhaltung wichtig ist, bleibt das "Ding an sich unerkennbar" (POPPER, nach 1.18).
Das menschliche Erkennen wird hier also strikt an die biotischen
"Grenzen" exakter Wahrnehmungen gebunden. Andererseits weiß VOLLMER durchaus zu unterscheiden: "In der Wahrnehmung erfolgt diese Rekonstruktion unbewußt und unkritisch, in der Erfahrung dagegen bewußt, wenn auch noch unkritisch, in der theor. Erkenntnis dagegen schließlich bewußt und kritisch. Kein Tier hat theoretische Erkenntnis." (VOLLMER in 17,80f.) Damit sollte die vom Tier abgeleitete Erkenntnistheorie nicht so einfach auf den Menschen übertragbar sein. Tatsächlich begründet VOLLMER (7,45), daß die EE weiteres Wissen z.B. über die Art und Weise, wie Erkenntnis entsteht benötigt, was er mit seiner Projektiven Erkenntnistheorie hinzufügen will.
Er stellt auch ausdrücklich fest, daß die EE nicht
die Evolution menschlicher Kenntnisse erklären will, dies
sei Aufgabe der Wissenschaftstheorie (7,47). An dieser Stelle
ist für ihn auch klar, daß die kulturelle anderen,
als nur biotischen Gesetzen unterliegt (7,48).
E.OESER erklärt auch ausdrücklich, daß die Anpassung
nicht ausreichend zur Erklärung menschlicher Erkenntnis ist,
da wir ja die uns angeborene "Brille" durchaus abnehmen
können. Für das menschliche Erkennen ist der Passungscharakter
nicht mehr entscheidend, "sondern die Fähigkeit,
konstruktiv Modelle der Realität zu entwerfen, die nachträglich
mit den Erfahrungstatsachen der Wahrnehmung verglichen werden"
(OESER 7,272). Dadurch ist es dem Menschen möglich, die phylogenetisch erworbenen Grundlagen des Erkenntnisvermögens zu überwinden (7,283). Gemeint ist damit die einfache Erfahrung, daß uns zwar unsere Wahrnehmung sagt, daß sich die Sonne um die Erde herum dreht - daß wir aber durchaus wissen können, daß sich tatsächlich die Erde um die Sonne bewegt. " Die optische Täuschung ist für das Auge unaufhebbar, nicht für das Denken... die Täuschung des Denkens ist prinzipiell durch Denken aufhebbar."(LÖW 7,337)
Diese Überwindung des phylogenetisch erworbenen Erkenntnisapparats
ist für OESER geradezu das Ziel der Wissenschaft. Bereits ENGELS nennt in seiner "Dialektik der Natur" mehrere Beispiele für die Überwindung von biotischen Erkenntnisschranken durch den Menschen:
Wir sind sind in der Lage, zusätzlich zu den angeborenen
Maßsystemen andere geometrische Maße anzuwenden und
Messungen als Grundlage für wissenschaftliche Aussagen durchzuführen
(vgl. V.BORZESZKOWSKI/WAHSNER in DIALEKTIK 1/91 S.183).
Die zusätzlichen Mittel des Menschen bilden nun nicht etwa
das Urbild "exakter" ab als eine Spiegelung es könnte,
sondern sie geben die Möglichkeit, tiefer in das Wesen
der Dinge einzudringen. "Weil die Welt eben nicht genauso
ist, wie sie sich unseren Sinnen darbietet, können wir uns
ein durch die Mannigfaltigkeit der Objekte hindurchblickendes
Bild von der Welt machen" (MOCEK: 19,43). Daß nicht das Nachvollziehen einer unendlichen Kausalverkettung das Ziel wissenschaftlicher Erkenntnisse ist, sondern eine "Beschränkung" auf wesentliche Zusammenhänge sinnvoll ist, beschreibt S.LEM damit, daß die Natur selbst so vorgeht: "Müßte die Natur Impuls, Spin und Moment jedes einzelnen Elektrons bei der Regelung berücksichtigen, dann hätte sich niemals lebende Strukturen errichtet" (LEM: 20,383).
Unter der Oberfläche der Phänomene wird so die "innere
Physiologie" der Vorgänge aufgedeckt (MARX in Theorien
über den Mehrwert). Es geht also bei dem wissenschaftlichen Erkennen
um das Aufspüren innerer Zusammenhänge, das Vordringen
zum Wesen und damit zu den Gesetzmäßigkeiten. Weil die EE auf die Evolution kognitiver Fähigkeiten beschränkt ist, und ihre Aufgabe nicht die Untersuchung der ihrer theoretischen Überwindung ist, kann sie auch nicht so recht sagen, was Wissenschaft eigentlich ist. Sie bleibt an dieser Stelle bei allgemeinen Aussagen stehen (vgl. LORENZ 1,9). Ebenso verweisen sie bei der Frage nach dem Zustandekommen eines wissenschaftlichen Fortschritts auf vage Analogien zum biotischen Mutations-Selektions-Prozeß.
Wenn sie den Geltungsbereich
nicht über ihre Möglichkeiten hinaus ausdehnen, ist
das auch kein Manko.
Die folgenden Punkte (2.4.2. bis 3.) diskutieren einige Fragen,
denen sich die EE wegen Beschränkung auf die biotischen
Grundlagen des Erkennens nicht stellen kann. Um diese Einschränkung
deutlich zu machen, und weil die Themen interessant sind, seien
sie aber hier diskutiert.
2.4.2. Wissenschaftliches
Erkennen
Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle angedeutet,
welche weiteren Faktoren, die über das tierische Erkennen
hinausweisen, für die wissenschaftliche Erkenntnis
wesentlich sind.
a) Selektion im "Netz"
des Wissenschaftlers
Da die "Erscheinung stets reicher als das Wesen" ist
(LENIN), müssen überflüssige Informationen herausgefiltert
werden. Bewußte Selektionen geschehen im wissenschaftlichen Erkenntisprozeß an verschiedenen Stellen:
Es ist klar, daß hier eine rein biologisch argumentierende Erkenntnistheorie nicht mehr viel aussagen kann. Die mögliche Variation der Auswahlkriterien verweist auf die Möglichkeit einer Betrachtung von mehreren Standpunkten unter verschiedenen Fragestellungen.
Das Hinzunehmen vorher vernachlässigter Kontexte, das Überschauen
von Zusammenhängen zwischen Systemen verschiedener Strukturniveaus,
die heuristische Funktion von Isomorphien und Ähnlichkeiten
führten z.B. G.BATESON (22) zu vielfältigen neuen Hypothesen
und Entdeckungen. An dieser Stelle wird auch klar, warum eine Wissenschaft, die sich nicht mehr bewußt ist, daß sie jeweils nur Teile der objektiven Realität ("Teile des Kreisbogens" G. BATESON) wahrnimmt, nicht mehr der Aufgabe der Wissenschaft, das Wesen der Prozesse und die inneren Zusammenhänge aufzudecken, gerecht werden kann.
Leider wird genau diese Abweichung von der Wissenschaft oft als
das Bild der Wissenschaft dargestellt, was zur Suche nach
Auswegen im Irrationalismus verführt. Es reicht nun nicht aus, Objekte zu isolieren, zu idealisieren (also von unwesentlichen Elementen zu befreien), um dann wesentliche Aussagen über sie zu machen. Schon bei der Idealisierung benutzt man als "Auswahlkriterium" theoretische Zusätze zur rein empirischen "Datensammlung" (vgl. 18, S.222)
Dabei gibt es keinen eindeutigen Weg von den experimentellen
Befunden zu den Gesetzesaussagen (RÖSEBERG,23, S.43).
Bereits die sinnliche Wahrnehmung verbindet die Selektion mit der konstruktiven Gestaltbildung. Dabei ermöglichte es die "unscharfe Modellbildung", die Wirklich- keit intuitiv und ganzheitlich zu erfassen, ohne auf exakte Einzelinformationen "warten" zu müssen(vgl.LEM, 20, S.235f). Dies war während der vorwiegend biotisch-determinierten Evolution sicher ein Selektionsvorteil, der sich über den Symmetriebruch der Anthropogenese hinaus in Form des bewußten Denkens potenziert entwickelt hat. Eine Form der "Konstruktion" ist z.B. die Intuition, die Kreation von neuen Erkenntnissen über eine "Heureka-"erkenntnis beim plötzlichen "Zusammenschnackeln" von zwei vorher unabhängigen Sachen ("Fulguration", LORENZ, 8, S.26).
Der Weg der Erkenntnis ist somit keine einfache Aufeinanderfolge
von Versuch und Irrtum (Herausselektieren der "richtigen"
aus allen möglichen Variablenkombinationen), sondern vollzieht
sich über Vermutungen und Hypothesen.
Einstein schrieb über Kepler: "Es scheint, daß
die menschliche Vernunft die Formen erst selbstständig konstruieren
muß, ehe wir sie in den Dingen nachweisen. Aus Keplers wunderbarem
Lebenswerk erkennen wir besonders schön, daß aus bloßer
Empirie allein die Erkenntnis nicht erblühen kann, sondern
nur aus dem Vergleich von Erdachtem mit dem Beobachteten"
(A.EINSTEIN,Mein Weltbild S.197, vgl. R.WAHSNER in DZfPh 5/81
S. 531ff.). Während E.MACH als wissenschaftliche Theorie nur die Anpassung der Gedanken aneinander verstehen wollte, erkannte bereits BOLTZ- MANN, daß die Theorie relativ eigenständig sein muß. Ohne sie bekäme man keinerlei Zugang zu modernen Theorien wie Quantenoder Relativitätstheorie (vgl. RÖSEBERG, 27, S.28ff.).
Es ist nötig, Zusatzannahmen zu machen, die direkt nicht
zu beweisen sind (vgl. RÖSEBERG, 23, S.69).
Ohne die theoretische Annahme der Quantenstruktur der Energie
durch PLANCK in einem "Akt der Verzweiflung" (so beschreibt
er es in einem Brief an WOODS) wäre die Frage, wieso Atome
stabil bleiben, obwohl doch die Elektronen auf ihren (kreisförmig-beschleunigten)
Bahnen laufend Energie abgeben müßten, ewig unbeantwortet
geblieben (und ohne theoretische Vorüberlegungen gar nicht
erst gestellt worden).
Aufgrund der objektiven Unerschöpflichkeit der Objekte und
der Offenheit der Erkenntnisziele des Subjekts kommt es zu einer
Vielfalt möglicher Abbilder eines Objekts. Mit dem Anspruch einer "völlig neuen Erkenntnis" macht seit einigen Jahre die sog. Bootstrap-Theorie Furore. Der Physiker CHEW entwickelte aus der Tatsache, daß stark wechselwirkende Quanten-Teilchen nicht mehr als isolierte Teilchen auftreten (S-Matrix-Theorie), sondern sich stets ineinander umwandeln, sie nur in Beziehungen existieren, eine "neue" Weltanschauung: "Das materielle Universum ist ein dynamisches Gewebe zusammenhängender Geschehnisse." (CHEW nach CAPRA, 24,S.54). Die Materialität verschwindet bei CAPRA dann auch noch: "Die beobachteten Strukturen der Materie wären somit Spiegelungen der Struktur unseres Bewußtseins." (CAPRA, 25, S.99). Der reale Kern dieser Theorie ist, daß es nicht möglich ist, fundamentale Bausteine der Materie oder fundamentale Gesetze zu finden, sondern stets ein Beziehungsgeflecht vorliegt.
Diese richtige Grundansicht wird allerdings verabsolutiert, wenn
nun im Gegenzug die wechselwirkenden Quantenobjekte zum Funda-
ment der Welt-Sicht gemacht werden. Die Realität wird hinter
rücks auf diese Beziehungsgeflechte (im Elementarteilchenbe-
reich) reduziert und es werden keine unterschiedlichen Struk-
turniveaus anerkannt. Bereits HEGEL stellte fest, daß die KANTschen Antinomien nicht vom Unvermögen des Verstands herrühren, sondern die Welt selbst dialektisch widersprüchlich ist.
Jedes Objekt stellt eine dialektische Einheit einander entgegen-
gesetzter Seiten, Tendenzen und Prozesse dar, die einander ausschließen,
aber miteinander zusammenhängen. "Sie bedingen sich
gegenseitig, bilden eine Einheit, existieren nicht losgelöst
voneinander und befinden sich gleichzeitig in Widerstreit."
(GROPP nach 15,S.50). Solche Widersprüchlichkeiten liegt vor
 Die Vielfalt der Abbilder sollen im Falle "sich (durch unterschiedliche Bedingungen) gegenseitig ausschließender, aber richtiger" (BOHR) Abbilder komplementär genannt werden.
Eine spezielle Art der Komplementarität beschreibt z.B. E.P
FISCHER (14) in Form der "schichtübergreifenden Komplementarität".
Gemeint ist die Sicht auf zusammengesetzte Körper aus unterschiedlichen
Richtungen: " Entweder man orientiert sich an den Teilen
oder man beginnt mit dem Blick auf das Ganze" (14,22). Das Verabsolutieren jeweils einer Sicht führt jedoch zum Reduktionismus- es ist notwendig, alle Bilder aufeinander bezogen zu verwenden (eine einfache Reduktion aufeinander ist nicht möglich, wenn sich - wie für die Komplementarität vorausgesetzt - die jeweiligen Bedingungen gegenseitig ausschließen). K.LORENZ setzt sich an mehreren Stellen vehement gegen die "Nichts- Alserei" (ein Ding sei "nichts als" anstelle eines "sowohl als auch") ein, bei der eine solche Reduktion versucht wird. "Erst die Gesamtheit aller Seiten eines Gegenstands realisiert die Wahrheit." (LENIN, LW Bd.38 S.186).
Nur auf dem Wege einer so dialektisch verstandenen Wissenschaft
wird es möglich sein, daß "die Menschen (sich)
wieder als Eins mit der Natur nicht nur fühlen, sondern
auch wissen..." (ENGELS, MEW Bd.20, S.453). Diese Einheit mit der Natur scheint auf dem Wege der Wissenschaft verloren gegangen zu sein. Die Ursache nur in geistigen Prozessen zu sehen, führt dazu, der Wissenschaft als geistigem Prozeß dafür die Schuld zu geben. Dem Irrationalismus sind dann Tür und Tor geöffnet. In Wirklichkeit wird die Gesamtheit wissenschaftlichen Erkennens aus anderen Gründen im praktischen Forschungsprozeß reduziert. Es ist nicht das Unvermögen oder der fehlgelenkte Wille der Forscher, sondern ihre Einbindung in den Kapitalverwertungsprozeß, die die Wissenschaft in eine Sackgasse treibt. Werden die Ursachen jedoch nur im geistigen Bereich vermutet, geht auch der Kampf gegen diese Einseitigkeit ins Leere und wird wiederum vom Kapital verwertet, diesmal ideologisch gegen einen Anspruch der wissenschaftlichen Erklärung der Welt.
Und doch ist es notwendig, darüber hinaus zu gehen. Nicht
der technizistisch-rationalistische Weg ist der Richtige- aber
auch nicht die Flucht ins Irrational-Mystische. Die Dinge sind
komplizierter und im folgenden Gliederungspunkt auch nur leicht
angetippt und nicht genügend durchgearbeitet. Immer wieder
jedoch werden wir uns auf die Gratwanderung zwischen übertriebener
und einseitiger Rationalität und der in die andere Richtung
übertriebenen Irrationalität begeben.
Die streng wissenschaftliche Untersuchung ist immer nur eine der
möglichen Formen, die Umgebung widerzuspiegeln, sich zu ihr
ins Verhältnis zu setzen. Auch der strenge, "engere" Erkenntnisprozeß, der auf eine "Entsubjektivierung" zielt, nimmt Vor-Wertungen vor (z.B. ist die Wahl der Erkenntnismethoden vom Forschungsziel abhängig) und ermöglicht die nachfolgende Ver-Wertungen. Erkenntnis in diesem Sinne ist aber eher auf eine Objekt- Abbild-Relation beschränkt. Erst der weitere Begriff umfaßt nach ERPENBECK (15,167f.) Wertungen und Prozesse der Erkenntnis als Gesamtheit aller individuell-psychischen und historisch- gesellschaftlichen Bewußtseinsprozesse. Hier liegt dann eine Objekt- Subjekt- Abbild- Relation vor (15,139).
D.h: "Das Abbild vertritt das Objekt entsprechend den Interessen
und Aktivitäten des Subjekts". Diese Interessen sind wesentlich beeinflußt durch den materiellen Lebensprozeß: "Bei mir ist ... das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle" (MEW Bd. 23 S.27).)
Auf diese Weise gelangen wir zu einer zusätzlichen Aneignungsform
der Wirklichkeit, die neben der theoretisch-geistigen autritt:
die praktisch- geistige. MARX erkennt weiterhin die ästhetisch-
geistige und die religiös-geistige Aneignung der Wirklichkeit
an (entspr. neuerer Transkr. MEW Bd.13 S.633). All diese Aneignungsformen hängen miteinander zusammen, ihre Wechselbeziehungen sind nicht trivial.
C.F.v.WEIZSÄCKER (26, 449ff.) hat eine interessante Erklärung
für die Differenz westlicher und östlicher Denkweisen
und ihr jetziges Bestreben, einander näher zu kommen. Die
für ein bewußtes Denken notwendige Trennung von Wahrnehmung
und Bewegung, also das Abheben einer theoretischen, verstandesgemäßen
Betrachtung der Wirklichkeit, die zu Wissen führt von der
Praxis, die auf freiem Willen beruht und Macht ermöglicht,
führt zu der Situation, daß das Handeln zwar zielbewußt
erfolgt, aber die Zwecke selbst recht wenig Vernunftentscheidungen
unterliegen, eher spontan gebildet werden. Abgesehen davon, daß
die Zwecke in der Praxis durchaus durch gesellschaftliche Verhältnisse
recht festgelegt und nicht beliebig "spontan" entwickelbar
sind, zeigt sich eine interessante Übereinstimmung mit HORKHEIMER.
Dieser kritisiert, daß die vorherrschende "instrumentelle
Vernunft" zwar in der Lage ist, die Auswahl von Mitteln zur
Erfüllung von Zielen durchaus rational zu vollziehen (eine
effektive Produktion zu organisieren), daß in der Gegenwart
die Ziele des Handelns eher irrational und nicht durch Vernunft
kontrolliert sind (Produktionsziel selbst irrational).
Aus diesem Widerspruch leitet WEIZSÄCKER die Notwendigkeit
ab, die bisherigen Formen des Wissens durch eine gezielte Wahrnehmung
des Ganzen zu ergänzen und die bisherige machtorientierte
Praxis durch die Sittlichkeit. Daß dies noch nicht realisiert
ist, stellt einen Mangel an Kultur dar. Dieser führt zu den
bekannten Bestrebungen, diesen Mangel über einen Kult an
östlichen Kulturen ausgleichen zu wollen. Damit erfaßt WEIZSÄCKER meiner Meinung nach einen erkenntnistheoretischen Hintergrund der gegenwärtigen Esoterik- und New-Age-Welle. Tatsächlich liegt der Gedanke nicht weit, auf eine Wissenschaft, die in der Gegenwart ihren instrumentellen Charakter als bloßes Machtmittel nicht leugnen kann, ganz zu verzichten. Wenn auch die Gurus dieser Ansichten selbst durchaus ein Bemühen zeigen, ihre Ansichten sogar mit Hilfe "neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse" zu untermauern (CAPRA ist Physiker), so gehen sie selbst innerhalb ihrer Fachwissenschaft sehr unwissenschaftlich vor (das kann man anhand der verwendeten Quantenphysik bei CAPRA schön zeigen) und haben für alle "konservativen" Fachkollegen nur Hohn und Verachtung übrig.
Der Verzicht auf technokratische Steuerungsmethoden und die realsozialistische
Versionen der In-Dienst-stellung der Wissenschaft für eine
Ver-Planung menschlichen Lebens führt auch bei alternativen
Politikansätzen zu einer Verschiebung zuungunsten von wissenschaftlicher
Arbeit.
Auch WEIZSÄCKER sucht weiter nach einer "Begründung
der Werte im Lichte eines Bewußtseins" und findet
nicht zurück zu einem dialektischen Wissenschaftsverständnis.
Dieses wird aber auch erst möglich sein, wenn sich die Wissenschaft
selbst an den Stellen weiterentwickelt, an denen tatsächlich
neue Erkenntnisse aufbrechen.
LENIN analysierte die "Krise der Physik" angesichts
neuer Erkenntnisse zur Atomtheorie und Relativitätstheorie.
Er kam zu dem Schluß, daß diese neuen Erkenntnisse
die Wissenschaft "zur Dialektik zwingen". Heute stellt
das Vordringen neuer Paradigmen (Denkschemata, Rahmen für
ganze Wissenschaftsgebiete, wie das Selbstorganisationskonzept,
die Synergetik...) die gleichen Anforderungen. Leider ist die gegenwärtige Entwicklung eher davon bestimmt, daß die Vertreter der neuen Gedanken sich mit Protest abwenden von der traditionellen Wissenschaft und die "Verteidiger" dieser Wissenschaft es im Kampf gegen die "Abtrünnigen" zu oft versäumen, das wirklich Neue zur Kenntnis zu nehmen.
Welche Akzente der "Meditationswelle" sind nun für
uns interessant ?
a) erkenntnistheoretisch:
1. Es ist tatsächlich notwendig, die Dinge und Prozesse in
ihren Zusammenhängen zu betrachten, sie als Totalität
zu erkennen. Es geht dabei um die genaue Untersuchung von Wechselwirkungen
zwischen Strukturniveaus auch weit entfernter Stufen (Ko-Evolution
Mikro-Makrowelt). Die Wissenschaft ist inzwischen selbst an den
Stellen, wo diese Wechselwirkungen wesentlich zum Verständnis
der untersuchten Prozesse werden (Quantentheorie und Kosmologie;
Mensch als Individuum und im Spannungsfeld der globalen Probleme
...). Eine Unterscheidung zu spekulativ-mystischen Weltbildern gibt die Forderung von ENGELS an materialistische Forschungen, nur die tatsächlichen Zusammenhänge zu akzeptieren und keine zu erdenken und zu erdichten. Wie dies gemacht wird, ist auffallend bei der Erfindung des Geistes aus der "Dynamik der Selbstorganisation" bei E.JANTSCH (29). Typisch ist auch, daß bei den neuen mythischen Weltbildern die objektiven Widersprüche ausgeschaltet werden und eine Harmonisierung ein "Ineinanderschwingen der kosmischen Harmonien", in die die Menschen sich einklinken müßten, dekretiert wird . |
||