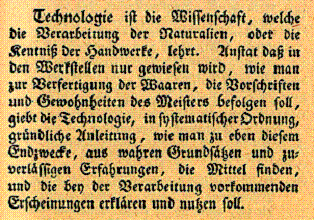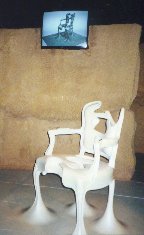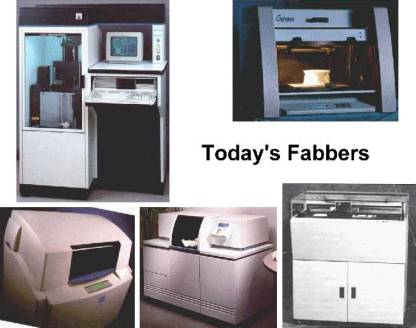|
Rapid Producing
Eine andere Produktionswelt ist technisch möglich Teil I |
Einleitung
Es ist nicht vorstellbar, dass eine
fortschrittliche Gesellschaftsform auf Produktionsformen beruht, die allein von
ihrer technischen Struktur her Menschen lediglich als „passive Produktionsinstrumente“
und als „bloße Zahnräder“ (Weil 1975: 134) verwendet. Welche Produktionsform
ist jedoch der selbstbewussten Verausgabung der individuellen Arbeitskraft als
gesellschaftliche Arbeitskraft gemäß? Lange Zeit hatte eine hochproduktive und
hochkomplexe Produktion zu immer mehr Zentralisierung und Normierung der
Arbeitsprozesse geführt, die einer Selbstbestimmung der arbeitenden Menschen
schon von der technischen Struktur her im Wege standen. Wir gehen davon aus, dass die technische
Mittel erstens eine Selbstbestimmung der Menschen, also eine Angepasstheit an
ihre konsumtiven und produktiven Bedürfnisse in ihrer Verschiedenheit (vgl.
Schlemm 2001) und in allen Regionen der Welt ermöglichen muss und zweitens
ökologisch nachhaltig im Sinne einer „Allianztechnik“ (Bloch 1985: 802ff.;
siehe auch Schlemm 1995) sein muss. Auf dieser Grundlage wird „die Technik“
nicht als etwas grundsätzlich Verwerfenswertes betrachtet, sondern als Mittel,
mit dem menschliche Zwecke erfüllt werden. Diese Zwecke kann sie mehr oder
weniger gut erfüllen – und die Zwecke können den menschlichen Bedürfnissen und
Möglichkeiten entspringen oder ihnen auch widersprechen.
Alternative Techniken beziehen sich
meist auf den Bereich der Energieversorgung und der Entsorgung der Produktions-
und Konsumtionsabfälle. Für die Erzeugung der materiellen Güter stehen vor
allem handwerklich orientierte, vorindustrielle Techniken als Alternative zur
Debatte. Dabei erscheint der Pfad der industriellen Produktion im Sinne der
„Megamaschine“ (Mumford 1974) meist als Irrweg, der bald verlassen werden
sollte. Die Entfaltung und jetzige Verwendungsweise der industriellen
Produktion ist eng verbunden mit einem Zweck der Produktion, der sich von den
menschlichen Bedürfnissen entkoppelt hat und einseitig mit kapitalistischen Profitmaximierungserfordernissen
verbunden ist. Jedoch ist diese verfehlte Zwecksetzung nicht den Mitteln selbst
notwendigerweise immanent. Ein typisches Evolutionsprinzip ist der
Funktionswechsel (Schlemm 1996: 78, 144). Dabei entwickeln sich historisch
bestimmte Strukturen, die bestimmte Leistungen, also Funktionen ermöglichen. Wenn
sich der Gesamtkontext der Funktionsweise verändert, können vorhandene
Strukturen dazu dienen, neue Funktionen zu erbringen, wobei sie sich selbst
dann auch wieder mit verändern. Die Entwicklung von aufeinanderfolgend
komplexer werdenden Funktionsweisen beruht geradezu auf dieser Aufeinanderfolge
von immer weiter entwickelten Strukturen. In eben diesen Sinne können
vorhandene technische (und organisatorische) Lösungen unter verschiedenen
gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedliche Zweck- und Zielsetzungen
erfüllen helfen. In der Aufeinanderfolge der menschlichen
Produktionsweisen kommt es neben der Absicherung des Überlebens und des guten
(d.h. auch ökologisch verantwortbaren) Lebens aller Gesellschaftsmitglieder
darauf an, die Lebenszeit der Individuen immer mehr zu befreien von den nicht
selbst bestimmten notwendigen Arbeitstätigkeiten. Deshalb muss die Arbeitsproduktivität
steigen, wenn nicht Verlust an Lebensqualität und Mehrarbeitszeit in Kauf
genommen werden soll. Bei hoher Arbeitsproduktivität ist der schon von der
Produktionsform her gegebene Freiraum für Selbstentfaltung, Kreativität und
befreiter Lebenszeit größer.[3]
Zwar nimmt uns keine Technik die politischen,
sozialen und ökonomischen Kämpfe ab, die der notwendige Wechsel der
Zwecksetzung der Produktion erfordert – aber diese Kämpfe haben weder Ziel noch
Motivation, wenn wir die technische Frage nicht auch diskutieren. Die Vision: der Persönliche Fabrikator
Es gibt eine interessante Parallele
zwischen der Entwicklung von Computern und Fabriken. Die ersten Computer waren
„gigantische Maschinen, eigens in speziellen Räumen untergebracht, nur von
spezialisierten Technikern zu bedienen, vorwiegend für industrielle Anwendungen
gedacht und nur für einen kleinen Markt vorgesehen“ (Gershenfeld 2000: 77). All
diese Merkmale treffen heute auch für die meisten Werkzeugmaschinen zu. Wir
wissen, dass sich die Situation bei den Computern radikal geändert hat. Die
Computer sind klein, überall verwendbar, von kleinen Kindern bedienbar, für
alle möglichen Zwecke einsetzbar und nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Warum sollte solch ein Umschwung nur für die Produktion von Bits und Bytes (und
Papier) möglich sein, und nicht für Atome und Moleküle? Warum sollen nur
2-D-Strukturen auf Papier gedruckt werden, warum sollen digital gespeicherte
Konstruktionen nicht auch als 3-D-Objekt aus entsprechenden 3D-Druckern kommen?
„Wären Computer imstande, Atome so bequem zu manipulieren wie sie Daten verarbeiten,
könnten wir auch unseren sonstigen Alltag weitgehend personalisieren“ (Geshenfeld
2000: 87). Viele von uns kennen auch die „Replikatoren“
aus der StarTrek-Serie. Auch in anderen Science Fiction-Geschichten wird
erahnt, dass es möglich ist, direkt aus Bits und Atomen Produkte herzustellen.
Neue TechnikenSo utopisch, wie es scheint, sind diese
Visionen gar nicht mehr. Leider erleben die am meisten ausgebeuteten Menschen
oder diejenigen, die sowieso am Rande der Gesellschaft leben, gar nicht, was
sich im Bereich der materiellen Produktion an neuen Möglichkeiten entwickelt
hat. Dies ist eher das Thema der aufstrebend-unkritischen Manager- oder Möchtegern-Managereliten
und der kapitalistisch-neoliberalen Marketingpropaganda. Als solche wird sie
von alternativ orientierten Menschen eher bekämpft als in ihren Möglichkeiten
wahrgenommen. Diese Einseitigkeit versperrt aber die Sicht auf eine
wesentliche Komponente von Befreiung.
„Factory in a box“
Aber es gibt noch mehr. Es gibt mittlerweile
„digitale Fabrikatoren“, sogenannte „Fabber“, die automatisch dreidimensionale
solide Gegenstände auf Grundlage digitaler Daten herstellen
(http://www.ennex.com/~fabbers/). Leider sind die jetzt realisierten Fabber
noch groß, teuer und verwenden oft toxische Ausgangsprodukte. Grundsätzlich
aber ist die Situation vergleichbar mit der Anfangszeit der Computer, wo der
damalige Zustand der Größe, Kostenintensität und Kompliziertheit sich
erstaunlich schnell gewandelt hat.
Während analoge Prozesse direkt mit
einem Material die Form des anderen beeinflussen, wie beim Gießen, gehen
digitale Prozesse von Information aus. Digitale subtraktive Prozesse werden in
NC- (numeric control) und CNC- (computer-numerically controlled) maschinen
realisiert. Die für die Zukunft wichtigsten[5]
Fabber beruhen auf additiven Techniken.
(Additiv wirkende) Fabber ermöglichen die
direkte Herstellung von Bauteilen und Produkten mit inneren Hohlräumen. Es ist
auch zu erwarten, dass durch den schichtweisen Aufbau auch elektronische
Mikroschaltkreise eingebaut werden können. Auch in sich bewegte Objekte können
auf einmal hergestellt werden. In additiven Verfahren können neuartige Materialien
verarbeitet werden. Letztlich sind auch mit einzelnen Atomen agierende Prozesse
hier denkbar (Nanotechnologie). ... hier solls noch weiter gehen... Wir haben inzwischen eine Präsentation dazu vorbereitet und können diese nach Absprache in div. Workshops zur Diskussion stellen.
Anfragen bitte unter info@zw-jena.de LiteraturBeckmann, Johann (1802): Anleitung zur Technologie
oder zur Kentniß der Handwerke, Fabriken und Manufacturen, vornehmlich derer,
welche mit der Landwirthschaft, Polizey und Cameralwissenschaft in nächster Verbindung
stehn.
Göttingen. [1] Marx MEW 23: 92. [2] Unter Technik ist demgegenüber zu verstehen: Handlungsform, mit der „einheitlich die Beziehungen des Menschen zu sich selbst, zu anderen und zur Umwelt in seinen wichtigsten Handlungszusammenhängen reguliert wird“ (Krohn 1976: 43). [3] Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, als wäre Ausbeutung und Herrschaft notwendig mit zu niedriger Arbeitsproduktivität verbunden, weil damit alle Befreiungsversuche delegitimiert würden. Gleichzeitig darf aber auch nicht angenommen werden, dass die Möglichkeiten eines freien, guten Lebens unabhängig von der erreichten Arbeitsproduktivität seien. [4] Gershenfeld 2000: 90. [5] In der Beschriftung der Abbildung 5 bezieht Burns alle formgebenden Techniken auf Fabber, später nennt er nur die auf additiven Prozessen beruhenden Maschinen Fabber. |
(Reiner Nebelung: aus "Herrschaftsfrei wirtschaften".) S. 62-69.
 |
Dieser Text erschien im Buch "Autonomie und Kooperation" zu bestellen für 14 Euro (Rabatt für Mehrfachbesteller) bei http://www.herrschaftsfrei.de.vu/ |