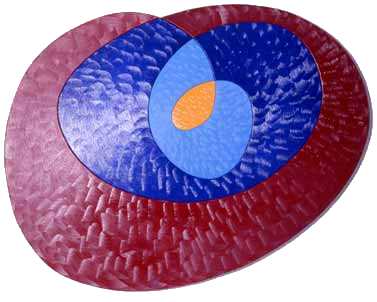|
Totalität / Totum bei Hegel und Bloch |
 |
|
Die Bezeichnung "Totalität" verweist auf "Vollständigkeit, Abgeschlossenheit, Vollkommenheit und Aufeinanderbezogensein in einem übergreifenden Systemganzen" (Wikipedia).
Lange Zeit galt es auch als unstrittig, dass die Philosophie als System zu betreiben ist. Darunter verstand Kant die Bildung einer "Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Das dabei entstehende Ganze "ist also gegliedert (articulatio) und nicht gehäuft (coacervatio); es kann zwar innerlich (per intus susceptionem), aber nicht äußerlich (per appositionem) wachsen" (Kant KW 4: 695 f.)
Angesichts des postmodernen und postmarxistischen Mainstreams auch in linken und emanzipativen Debatten hat es der Totalitäts-Begriff aber inzwischen schwer, akzeptiert und verstanden zu werden (siehe auch König, Markl 2001).
1. Hegels Begriff von Totalität
Für Hegel war der Gedanke einer philosophischen Systematik zentral:
Eine Totalität ist nicht nur das Anhäufen von Wissensinhalten und es ist auch nicht nur eine geordnete Sammlung. Auch eine Übersetzung mit dem Wort "Gesamtheit" wäre zu unscharf. Hegel unterscheidet sogar die Begriffe Ganzheit und Totalität deutlich voneinander (vgl. Schlemm 2007, Pisarek 1995: 229). In einer Ganzheit werden das Ganze und die Teile zwar aufeinander bezogen, aber die Teile werden noch als unmittelbar selbständig betrachtet (HW 6: 165). Für eine Totalität gilt jedoch, dass ihre Momente nicht mehr selbständig sind, sondern jede Seite ist "als Moment der anderen gesetzt" (ebd.: 166). Marx verdeutlicht dies am Verhältnis der Momente Produktion, Zirkulation, Austausch und Distribution (MEW 42 E: 24 ff.). Sie bilden "alle Glieder einer Totalität [...], Unterschiede einer Einheit" und "die Produktion greift über" (ebd.: 34). "Eine bestimmte Produktion bestimmt also eine bestimmte Konsumtion, Distribution, Austausch und bestimmte Verhältnisse dieser verschiednen Momente zueinander. Allerdings wird auch die Produktion, in ihrer einseitigen Form, ihrerseits bestimmt durch die andren Momente." (ebd.)
Das Ganze und die Teile sind zwar auch "sich gegenseitig bedingend und voraussetzend" (ebd.: 165) aber ihr Verhältnis ist noch "äußerlich und mechanisch" (HW 8: 268 § 135 Zusatz). Hegel verwendet das bekannte Beispiel von den Körperteilen eines lebenden Organismus und bezeichnet als Teile eines Ganzen lediglich die Glieder eines Kadavers (ebd.). Das, was der Gesamtheit des Lebens entspricht, wird bei Hegel zur "Totalität". Diese Totalität ist nicht nur eine um Lebendigkeit und Wirksamkeit angereicherte Ganzheit, sondern wenn etwas als Totalität betrachtet wird, werden nicht mehr unmittelbare Dinge oder Gegebenheiten in ihrer Verbundenheit betrachtet, sondern es geht um die inneren Momente eines Gegenstandes, die nicht als unmittelbare Teile auftreten, sondern eher als qualitative Momente. Eine Gesellschaft als Totalität zu betrachten, sieht sie nicht als Gesamtheit der Individuen, sondern als Gesamtheit der qualitativen Aspekte, die die Gesellschaft in ihrer Einzigartigkeit ausmachen. So ist die Produktion in einer Gesellschaft eine Einheit von Produktion, Konsumtion, Distribution und Austausch (MEW 42 E: 24 ff.). Die Totalität Produktion ist die Einheit ihrer Momente Produktion, Konsumtion, Distribution und Austausch. Wenn die Produktion auf diese Weise als Totalität erkannt ist, wird auch bei weiterem Erkenntnisfortschritt nicht plötzlich noch ein weiteres Moment auftauchen, um "Produktion" zu bestimmen (eine Totalität mit anderen Momenten ist dann auch eine andere Totalität).
Um als Totalität erkannt zu sein, müssen die Momente vollständig sein. Insofern ist eine Totalität abgeschlossen und diese Abgeschlossenheit und Vollständigkeit hat nichts mit Statik und "Fertig-Sein" zu tun. Denn, wie schon Kant vermerkte, auch wenn eine Totalität nicht mehr äußerlich wachsen kann, so kann sie sich innerlich präziser bestimmen.
Stellen wir dies noch einmal an einem Beispiel vor: Ein Lebewesen ist ein Ganzes, das aus vielen Teilen besteht: Kopf, Rumpf, Beinen, Organen, Fell etc., etc. Aber die Aufzählung der Teile, sogar wenn sie relativ vollständig ist, kennzeichnet das Lebewesen noch nicht als Totalität. Wenn wir nach der Totalität suchen, so meinen wir die Gesamtheit der Momente Stoffwechsel, Beweglichkeit, Fortpflanzung. Die Frage, welche Momente das Leben ausreichend kennzeichnen, ist genau die Frage nach der Bestimmung der Totalität des Lebens. In welcher Weise diese Totalität dann realisiert ist, ob durch Tentakel oder Beine, durch Zellteilung oder Sexualität, hat mit der Frage dieser Vollständigkeit nichts zu tun.
Eine Totalität ist insofern vollständig, als ihre Momente sie vollständig bestimmen. Anders ausgesprochen: Die Totalität wird nur durch Bestimmungen bestimmt, die in ihr selbst stecken, nicht von außerhalb. Ihre innere Struktur, ihr innerer Zusammenhang bestimmen sie. Sie ist frei von einer Abhängigkeit von Anderen, das nicht ihre eigenes Moment, ihre eigene Bestimmung wäre. (vgl. Erdmann 1864 § 140: 110, HW 10: 26 § 382 Zusatz). Eine Totalität setzt alle Veränderungen aus sich selbst heraus und ist somit Subjekt. Dabei bleibt sie bei sich selbst (HW 8: 309, § 161 Z); sie wird nichts Anderes, was noch außerhalb ihrer wäre. Etwas als Totalität zu begreifen bedeutet dann, es aus seinen eigenen Bestimmungen und Zusammenhängen zu erklären, als etwas, was sich selbst bedingt (Warnke 1977: 39). In der Hegelschen Philosophie ist dies die höchste Form der Erkenntnis und diese ist das alleinige Ziel der Philosophie.
Auffallend ist, dass eine Totalität auf keine ihrer bestimmenden Momente in ihrer spezifischen Besonderheit verzichten kann, sonst wäre sie nicht mehr vollständig. Deshalb ist eine Totalität niemals abstrakt allgemein, "nur formelle Identität mit sich" (HW 17: 267). Als konkret Allgemeines ist sie dagegen eine "Einheit von unterschiedenen Bestimmungen" (HW 20: 474).
Der Vorwurf des "Totalitarismus" an eine Philosophie, die Totalitäten denkt, ist deshalb ein Missverständnis. Er verwechselt genau die abstrakte Allgemeinheit, die er ablehnt, mit der konkreten, die kaum bekannt ist. Es geht dann um eine abstrakte Allgemeinheit im Sinne: "Subsumtion von allem und aller unter eines; Subsumtion des Einzelnen, des Individuellen unter das Allgemeine (oder Zentrale)" (Wahsner 1995: 236) Hegels Allgemeines, besonders in der Totalität ist dagegen konkret allgemein:
Wie Renate Wahsner deutlich macht, ist diese konkret-allgemeine Totalität bei Hegel lediglich ein "Ansatz zu einem Allgemeinen das nicht in der Subsumtion [...] unter das Allgemeine besteht" (Wahsner 1995: 237, kursiv A.S.) Eine der Beschränkungen bei Hegel ist, dass er die Produktion nur in der Begrifflichkeit der Zirkulation denkt (ebd.: 238). Wahsner vermisst auch bei Marx noch den Begriff der konkret-allgemeinen Arbeit (ebd.). Sie versucht erste Schritte in einer Konzeption des "kollektiven Individuums", d.h. eines sich durch das Gegeneinander der Gegenstände oder Individuen konstituierendes Ganzes, das als dieses Ganze als ein System oder ein Individuum höherer Ordnung aufgefasst werden kann (Wahsner 1993/1996: 186). Dieses Allgemeine sollte dann das von Moses Hess als "Für-einander-Sein" Bezeichneten begrifflich fassen.
Mehr zum Begriff "Totalität" und zu seiner Kritik bei Lukács, Korsch, Horkheimer und Adorno siehe bei König und Markl (2001).
2. Blochs Totum
Wesenheit macht sich dort nur als Ge-Wesenheit kenntlich (TE 276). Bei Bloch dagegen liegt das Wesen der Welt selber an der Front. (PH 18): "Das Eigentliche oder Wesen ist nichts fertig Vorhandenes..." (PH 1625) Das Wesen ist bei Bloch gerade "dasjenige, was noch nicht ist, was im Kern der Dinge nach sich selbst treibt, was in der Tendenz-Latenz des Prozesses seine Genesis erwartet" (ebd.). Für Bloch gilt:
Trotzdem ist das Totum auch für die Blochsche Philosophie notwendig. Als "begriffen Umfassendstes" (SO 30) wird es für konkrete Theorie und Praxis benötigt (ebd.: 11). Es "ist das zusammenhaltende Ziel der dialektischen Bewegung" (ebd.: 144). Es teilt sich als Tendenz mit (ebd.: 469 f.). Deshalb gibt es "keine Trennung zwischen Weg und Endziel", das "Totum befindet sich vielmehr in jedem Moment des Weges, sofern es überhaupt einer ist und nicht bloß eine Sackgasse." (SO 145) Für die menschliche Geschichte ist das Totum des Zielinhalts der "noch unausgemacht umgehende Menscheninhalt" (PH 1143) in dem das Allgemeine tönt oder tagt, "das jeden Menschen angeht und die Hoffnung des Endinhalts ausmacht: Identität des Wir mit sich und seiner Welt, statt der Entfremdung" (ebd.).
Aus diesem Grund entwickelt Ernst Bloch in seinen späteren Lebensjahren vor allem mit dem Buch "Experimentum Mundi" (EM) ein offenes System von Kategorialbegriffen, das sich nicht im Fragmentierten verliert.
|
![]() Zurück zur Startseite meines Hegelprojekts
Zurück zur Startseite meines Hegelprojekts